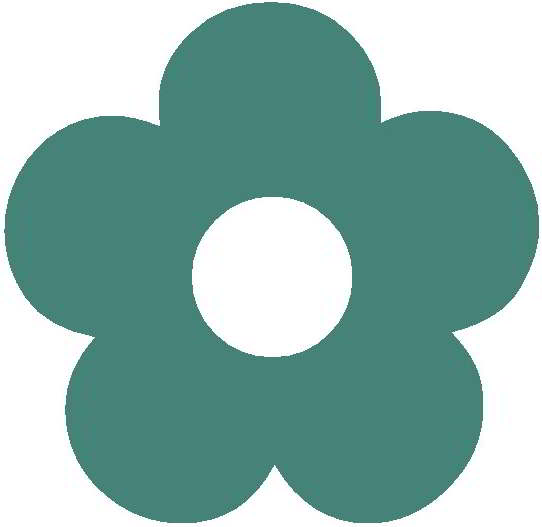Tipps für den Einkauf von Stauden, Ziergräsern und (bedingt) Gehölzen
Als Gärtner weiß ich, wovon ich rede, wenn ich sage "Augen auf beim Pflanzenkauf".
Bunte Bildchen auf den Pflanzenetiketten suggerieren uns nur allzu gern, dass der Traum vom eigenen Gartenparadies mit Stauden und Gehölzen zum Greifen nah ist, die oft dürftigen Informationen (vielfach als Symbole) zu Wuchshöhe, Standort etc. finden kaum noch Beachtung. Dabei sind gerade sie es, auf die es ankommt – so sie denn korrekt sind. Enorm wichtig ist auch die botanische Pflanzenbezeichnung, weil sich deutsche Pflanzennamen jeder selbst ausdenken darf; sie sind deshalb so aussagekräftig wie ein Wahlplakat.

Sicher sind Sie im Facheinzelhandel wie Gärtnereien oder Baumschulen am besten aufgehoben, wenn Sie Pflanzen einkaufen wollen, doch selbst dort gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen, denn auch dort sind die Pflanzen nun mal in erster Linie eine Einnahmequelle und keine Liebhaberei. Darauf sollten Sie also achten:
- Individuelle Beratung
- Botanische Pflanzennamen
- Kompakte Pflanzen und gut durchwurzelte Pflanztöpfe
- Aussagekräftige Informationen zur Pflanze
Das A und O – die Beratung
Wenn im Herbst Baumärkte, Gartencenter und sogar Supermärkte mit blühenden Gräsern locken, der Gärtner Ihres Vertrauens Sie jedoch aufs Frühjahr vertröstet, so ist das keine "Unlust", sondern Berufsehre: Viele Gräser stellen mit der Blüte nämlich das Wurzelwachstum ein und sollten dann nicht mehr gepflanzt werden, weil sie vor der kalten Jahreszeit nicht mehr "sesshaft" werden können. Wirklich und lange Freude hat man an den verlockenden Angeboten deshalb nicht.

Abelia mosanensis – Abelie
Andererseits ist es leider auch keine Seltenheit, dass einem eine bestimmte Pflanze, die man sich so gut im eigenen Garten vorstellen kann, "madig" gemacht wird, weil sie in der Gärtnerei oder Baumschule nicht im Sortiment ist. Aber verkaufen möchte man natürlich schon etwas. Also heißt es dann "nicht winterhart, viel zu empfindlich oder wird generell in den Gärtnereien und Gartencentern nicht mehr angeboten" – alles schon selbst erlebt. Wenn Sie sich vorab anhand von Fachliteratur damit beschäftigt und beschlossen haben, es könnte doch etwas für Sie sein, sollten Sie sich davon nicht verunsichern lassen, am Ball bleiben und weitersuchen.
Mir erging es vor vielen Jahren mit einigen Gehölzen (Bäume und Sträucher also) so: "Ja, da lesen die Leut' was, und wenn's im ersten Winter erfriert, sind wir schuld." Es handelte sich seinerzeit unter anderem um eine Abelia mosanensis (Koreanische Abelie), die sich nun schon seit Jahrzehnten bei mir im Garten bester Gesundheit erfreut. Meine ersten Exemplare konnte ich schließlich aus Stecklingen ziehen, die ich dankenswerter Weise aus dem Forstbotanischen Garten in Göttingen erhielt.
Auf die Kinderstube kommt es an

Frisch eingetroffen vom Jungpflanzenlieferanten, rasch umgetopft in die hauseigenen Standardpflanztöpfe und schon stehen die Pflanzen im Verkaufsquartier und gehen im günstigsten Fall gleich weiter an die Kunden. Besonders im Frühjahr ist dieses Vorgehen in vielen Gärtnereien und Gartenmärkten leider gängige Praxis. Zeit zum Erholen von Transport- und Umtopfstress geschweige denn zum Akklimatisieren im neuen Substrat und am neuen Standort bleibt den Pflanzen oftmals nicht.
Bessere Chancen, sich im heimischen Garten zu etablieren, haben Pflanzen, die gut in ihre Töpfchen einwurzeln durften. Wie dicht ihr Wurzelgeflecht sein sollte, wenn man sie kauft, hängt allerdings auch vom Wurzeltyp ab: Pflanzen mit Pfahlwurzeln wie zum Beispiel Teppich-Schleierkraut (Gypsophila repens), Bärenklau (Acanthus) oder Stockrosen (Alcea) bilden keine dichten Wurzelgeflechte. Bei ihnen ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn sie in höheren (manche sagen auch: tieferen) Töpfen stehen, in denen ihre langen Wurzeln genug Platz nach unten haben, ohne gestaucht zu werden.

Wie erkennt man aber gut durchwurzelte Pflanztöpfe? Von außen gar nicht. Wenn ich jedoch ein Töpfchen hochnehmen will und merke, dass es sich am Untergrund (Erde, Vlies) "festhält", dann ist es gut – bis zum Boden – durchwurzelt. Austopfen ist also nicht nötig. Töpfchen, die spürbar mit dem Untergrund verwachsen sind, sollte man übrigens nicht losreißen, wenn man sie nicht mitnehmen will: Einmal abgerissen, kann das beschädigte Wurzelsystem unter Umständen nicht mehr genügend Wasser aufnehmen und die Pflanzen verdursten.
Aussagekräftige Etiketten – Beratung in Kurzform und für zu Hause
Auf kleinen (Steck-)
Die Angaben auf Pflanzenetiketten und ihre Bedeutung:
| Wuchshöhe: | abhängig von Licht, Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit und dem Nährstoffangebot; unter "Wuchshöhe" ist auf www.gartenfreud-gartenleid.de – wie auch in den meisten Gärtnereien – immer die Gesamthöhe der Pflanzen angegeben |
| Blütezeit: | abhängig von Licht, Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Nährstoffangebot und Witterung |
| Blütenfarbe: |
bei einigen Gattungen und Arten abhängig von Feuchtigkeit, Bodenreaktion (PH-Wert) oder Licht; hinzu kommt die Wirkung der Farben auf das Auge je nach Lichtverhältnis: sie "verblassen" bei stärkerer Sonneneinstrahlung, wirken kräftiger an trüben Tagen 
|
Definition der Lichtverhältnisse:
|
sonnig: (Ⲟ oder "so") |
der Standort ist ganztags – zumindest aber in den Mittagsstunden (vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag) – sonnenbeschienen |
|
absonnig: (◍ oder "abso") |
ein heller Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung, vor allem nicht während der Mittagsstunden |
|
halbschattig: (◑ oder "hs") |
Flächen im Schatten von Gebäuden oder Gehölzen (im Osten oder Westen) mit weniger als einem halben Tag direkte Sonnenbestrahlung (mittags nie) |
|
schattig: (⯃ oder "s") |
Standort ganztags im Schatten von Gehölzen oder Gebäuden |
Die Lichtverhältnisse ließen sich noch feiner unterteilen, das ist meiner Meinung nach jedoch nicht erforderlich.
Definition der Bodenverhältnisse:
| trocken: | die Erde fühlt sich fast immer trocken an; trockene sandige Böden sind locker und staubig, trockene lehmige Böden sind fest und hart – meist an sonnigen Hanglagen mit gutem Wasserabzug oder im Regenschatten von Gebäuden zu finden |
| frisch: | außer während extremer Trockenheit oder nach heftigen Niederschlägen fühlt sich die Erde leicht feucht an; normaler Gartenboden ist frisch |
| feucht: | die Erde ist ganzjährig feucht, bei leichtem Druck tritt Wasser aus; feuchter Boden lässt sich formen, ohne zu zerbröckeln |
| nass: | ein in diesen Boden gegrabenes Loch füllt sich sofort mit Wasser |
Wie oft und ob eine Pflanze im Garten überhaupt gegossen werden muss, hängt also mit den Bodenverhältnissen zusammen und lässt sich nicht pauschalisieren. Mit einem bloßen Gieß-Symbol kann man deshalb nichts anfangen, man kann höchstens daraus Rückschlüsse auf den generellen Wasserbedarf einer Pflanze ziehen und bei der Standortwahl berücksichtigen. Je geeigneter aber die Bodenverhältnisse von vornherein sind, desto weniger muss die Pflanze gegossen werden; nach den Angaben zum Gießen auf dem Etikett darf man sich dann nicht mehr richten. Ziel sollte es im Garten schließlich sein, mit dem passenden Pflanzplatz die Ansprüche der Pflanzen zu erfüllen und – wenn sie eingewachsen sind – gar nicht mehr gießen zu müssen.
Manchmal angegeben: der Laubrhythmus
Der Begriff "wintergrün" wird inzwischen leider geradezu inflationär für alle Pflanzen verwendet, die im Winter ihr Laub behalten oder neu bilden. Solche Verallgemeinerungen sind nicht korrekt, denn es gibt viele verschiedene Laubrhythmen, die im Winter grünes Laub bescheren (nach Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland Band 5, Springer Spektrum, S. 33, 34), darunter immergrün (in verschiedenen Ausprägungen), frühjahrsgrün, herbst-frühjahrsgrün und herbst-frühsommergrün. DAS Wintergrün schlechthin gibt es nicht und es ist niemandem damit gedient, wenn er weiß, dass eine Pflanze zwar im Winter grün ist, dafür aber nur bis zum Frühjahr oder Frühsommer, weil sie anschließend bis zum Herbst einzieht, wie das bei den Herbst-Frühjahrsgrünen und den Herbst-Frühsommergrünen der Fall ist.
Die Stauden und ihre Lebensbereiche:
FR, G, SG – was wollen die von mir?
Vielfach werden die Stauden in den Gärtnereien heute (ihren) Lebensbereichen zugeordnet, zu erkennen an den Kürzeln auf den Etiketten, wie beispielsweise Fr (Freifläche), HG (Heidegarten) oder B (Beet). Das geht zurück auf die Autoren Hansen und Stahl (Hansen/Stahl, Die Stauden und ihre Lebensbereiche, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN 3‑8001‑6630‑5). Eine Gärtnerei fing damit an und alle anderen fanden's toll und zogen mit. Ich finde es nur kompliziert (erst recht für Laien) und unausgegoren, weil den Kunden zur Verdeutlichung des Prinzips lediglich eine kurze Zusammenfassung, ein kurzer Überblick über die einzelnen Lebensbereiche zur Verfügung gestellt wird (werden kann). Was genau dahintersteckt, wie diese Einteilung genau bei der Gartengestaltung und dem Pflanzen von Stauden umgesetzt werden kann, diese Informationen (müssen) fehlen.

Aber will man das als Kunde und im Garten überhaupt? Ich glaube eher nicht, deshalb verzichte ich in meinen Staudenporträts auf diese Einteilung, zumal ich meine, dass es schwer vermittelbar ist, dass ausgerechnet eine Staude wie zum Beispiel die Garten-Lupine (Lupinus polyphyllus) eine Beetstaude sein soll, nur weil es ihr guttut, wenn der Boden um sie herum säuberlich gelockert und gedüngt und gegossen wird. Überall in den Gärten wird hauptsächlich in Beete eingeteilt, egal, ob es sich dabei um eine freie Fläche (ohne Gehölze in der Nähe = Freifläche) oder ein Beet im Sinn von Hansen/Stahl handelt. Nicht alle Beete überall werden aufopferungsvoll gepflegt.

Fazit: Gut gemeint (von den Gärtnereien), nicht gut gemacht. Das schlechte Gewissen wird mitgeliefert, wenn man die Neuzugänge so pflanzt, wie man es immer gemacht hat – nach Licht-, Feuchtigkeits- und Bodenverhältnissen.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich will das Buch von Hansen/Stahl nicht schlechtreden. Ich halte es im Gegenteil geradezu für eine Pflichtlektüre für alle Staudenbegeisterten. Aber eben das ganze Buch, nicht nur die Schnipsel, die einem – aus welchen Gründen auch immer – allerorten serviert werden.