Tierischer Ärger im Garten
Was tun, wenn Blattläuse, Weiße Fliege, Schnecken und andere überhandnehmen?
Wer ärgert sich nicht tierisch, wenn ihm allerlei Getier einen Strich durch die sorgsam geplante (und oft auch teuer genug bezahlte) Garten-Rechnung macht? Unsere Umwelt, die Natur mit Flora und Fauna, liegt uns allen am Herzen, doch irgendwann ist das Maß voll und wir wollen uns gegen die Störenfriede wehren. Das gilt natürlich erst recht, wenn wir die Pflanzen, die wir kultivieren, irgendwann essen wollen. Dann wird's richtig haarig, schließlich hat es keinen Sinn, die Hälfte der Gemüsepflanzen oder mehr wegzuwerfen, nur weil man sie vorher allzu großzügig mit allerlei Getier geteilt hat und deshalb nicht mehr verwenden und verwerten kann.

Spanische bzw. Gewöhnliche Wegschnecke
Trotzdem muss die Frage erlaubt sein: Gehen wir mit dem Begriff und der Einordnung als "Schädling" nicht etwas zu sorglos um? Gut oder böse – schwarz oder bunt? Wundermittel gegen Blattläuse, Schnecken & Co. gibt es nicht – selbst dann nicht, wenn uns die Werbung das glauben machen will, und auch nicht für Gärtner. Die haben nämlich ebenfalls keine Patentrezepte. Was wir daher alle brauchen, ist ein wenig mehr Gelassenheit im Umgang mit allem, was da im Garten so kreucht und fleucht, gerade im Ziergarten, wo uns ja streng genommen nichts weggenommen wird.

Lilienhähnchen auf einer Lilie
An erster Stelle steht auf jeden Fall erst einmal die Analyse, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Dann gilt es abzuschätzen, wie groß die Beeinträchtigungen sind, die die Schädlinge verursachen, und die Frage zu klären, ob es natürliche Gegenspieler im Garten gibt und wie viele dieser Antagonisten da sind. Der Griff zu Pflanzenschutzmitteln sollte stets an letzter Stelle stehen, doch selbst dabei haben Sie meist noch eine Wahl und brauchen keinen Rundumschlag mit der chemischen Keule pur zu starten. Wer als Gärtner Pflanzenschutzmittel im Betrieb einsetzen will, benötigt übrigens einen Sachkunde-Nachweis für den Umgang mit diesen Mitteln. Für Hobbygärtner, im privaten Bereich also, wird für den Einsatz derselben Produkte die mehr oder minder qualifizierte Beratung in den Verkaufsstellen wie Baumärkten oder Gartencentern als ausreichend erachtet. Man muss nicht alles verstehen.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
Blattläuse – der Schrecken der Gärtner
Blattläuse sind in (fast) allen Farben auf (fast) allen Pflanzen vertreten

Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
 Die am häufigsten auftretenden Schädlinge an Pflanzen sind Blattläuse, ob im Ziergarten, an Gemüsepflanzen oder an Zimmerpflanzen; und es gibt – wie sollte es anders sein – die verschiedensten Arten davon. Blattläuse haben sich spezialisiert und häufig tritt eine Art nur an einer Pflanzengattung (oder sogar Art) auf. Deshalb kann eine Pflanze über und über mit Blattläusen besetzt sein, an anderen Pflanzenarten ringsum findet sich dagegen keine einzige.
Die am häufigsten auftretenden Schädlinge an Pflanzen sind Blattläuse, ob im Ziergarten, an Gemüsepflanzen oder an Zimmerpflanzen; und es gibt – wie sollte es anders sein – die verschiedensten Arten davon. Blattläuse haben sich spezialisiert und häufig tritt eine Art nur an einer Pflanzengattung (oder sogar Art) auf. Deshalb kann eine Pflanze über und über mit Blattläusen besetzt sein, an anderen Pflanzenarten ringsum findet sich dagegen keine einzige.

Ameisen "hüten" Blattläuse
Die Läuse schwächen die Pflanzen, indem sie diese bevorzugt an Wachstumspunkten mit ihren Stechwerkzeugen anstechen und die nährstoffreichen Säfte saugen. Da der Pflanzensaft sehr zuckerreich ist – die Blattläuse aber so viel Zucker nicht benötigen –, scheiden Blattläuse Zuckersaft aus, der sich auf den Blättern und um die Pflanzen herum ansammelt. Auf diesem Zuckersaft siedeln sich Schwärzepilze an, was wiederum dazu führt, dass die so "gezuckerten" Pflanzenteile kein Licht mehr erhalten; das bedeutet, dass die Pflanzen zusätzlich geschwächt werden. Gleichzeitig übertragen Läuse verschiedene Viren und verursachen dadurch sogenannte Virosen. Durch das Anstechen der Pflanze an den Wachstumspunkten entstehen an neuen Blättern und Trieben zudem Zellschäden, die als deutlich sichtbare Verformungen auffallen.

Gemeine Florfliege
Wohl jeder Gärtner hat schon bemerkt, wie Blattläuse von Ameisen "gemolken" werden. Ameisen an Pflanzen sind deshalb immer ein sicheres Zeichen für einen Schädlingsbefall (meist eben mit Blattläusen).
Zur Bekämpfung von Blattläusen gibt es viele Mittel und Methoden. Die einfachste im Ziergarten – und zudem die effektivste –, nämlich nichts zu tun, mag vielen widerstreben, hat aber die größten Erfolgsaussichten. Das Ganze funktioniert so:

Hungriges "Ungeheuer": die Florfliegenlarve
Treten Blattläuse auf, so dauert es eine gewisse Zeit, bis sich Nützlinge (u. a. Florfliegen, Marienkäfer und Schwebfliegen, deren Larven alle großen Appetit auf Blattläuse haben) einfinden. Die Nützlinge vermehren sich umso stärker, je mehr Schädlinge es gibt. Ein starker Befall von Blattläusen verschwindet nach einigen Wochen. Greifen Sie allerdings bei einem Befall sofort zur Giftspritze (egal ob biologische oder chemische Mittel), werden in der Regel nicht alle Läuse getötet und die Überlebenden sorgen in kurzer Zeit für den gleichen Befall wie vor der Spritzung. Nur mit dem Unterschied, dass ihnen dann weniger Nützlinge entgegentreten, weil für die ja vorübergehend Nahrungsknappheit herrschte.


Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Schneckenfraß an Paprika
Was ärgert uns denn an den Schnecken? – Dass sie unsere frisch gesetzten Salatpflanzen und/

Weinbergschnecke auf Garten-Bänderschnecke
Nur drei Arten Schnecken – allesamt Nacktschnecken – können im Garten wirklich zur Plage werden und im Zier- wie im Nutzgarten für erhebliche Ausfälle sorgen: die Garten-Wegschnecke (Arion hortensis), die Spanische bzw. Gewöhnliche Wegschnecke (Arion vulgaris, fälschlich auch: lusitanicus) sowie Genetzte Ackerschnecke (Deroceras reticulatum).
Schneckenbekämpfung sollte deshalb natürlich erfolgen oder mechanisch und die Entscheidung über Gut oder Böse, Leben oder Tod sollte stets ein Mensch treffen. Gift kann das nicht, es kann nicht unterscheiden. Egal welches. Es ist mir unverständlich, weshalb einerseits die Weinbergschnecken zum Beispiel besonders geschützt sind (seit 1980!), andererseits aber Schneckenkorn frei verkäuflich ist. Nematoden (Fadenwürmer) – die neueste "Erfindung" auf dem Gebiet der Schneckenbekämpfung, die sogar von Umwelt-Bundesamt empfohlen wird –, sind ebenfalls ein zweischneidiges Schwert. Sie sollen zwar Gehäuseschnecken verschonen und nur bei Nacktschnecken wirken, da allerdings dann wieder gegen alle und das zudem beispielsweise bei der Spanischen bzw. Gewöhnlichen Wegschnecke nicht so zuverlässig wie erforderlich.
Der schneckenunfreundliche Garten
Die natürliche Variante ist immer noch die beste Wahl: Schaffen Sie Lebensraum für Spitzmäuse, Maulwürfe, Stare, Drosseln, Amseln, Elstern, Frösche/

Weinbergschnecke
Mit einem Garten, der diesen Helfern das bietet, was sie brauchen, sorgen Sie für das nötige ökologische Gleichgewicht. Betrachten Sie Reisig- und Totholzhaufen also nicht als störende Elemente, sondern integrieren Sie sie, indem (einheimische) Pflanzen die abgestorbenen Äste flankieren. Lassen Sie herabgefallenes Laub unter Sträuchern und Bäumen liegen. Freuen Sie sich über viele Weinbergschnecken, selbst wenn umstritten ist, ob sie tatsächlich die Eigelege von Nacktschnecken vertilgen; sie richten jedenfalls nicht sehr viel Schaden an.

Igel
Igel werden in diesem Zusammenhang immer noch gern als Schneckenvernichter genannt, doch inzwischen weiß man, dass Igel gar nicht so sehr auf Schnecken stehen. Das ist auch gut so, denn mit den Schnecken könnten Igel Parasiten aufnehmen, die ihnen gar nicht gut bekommen. Das soll nun nicht heißen, dass Igel in unseren Gärten keinen Lebensraum bräuchten. Den benötigen sie sehr wohl – heute mehr denn je! Allerlei Wissenswertes rund um die Igel haben die Igelfreunde Ruhrgebiet e. V. auf Ihrer Homepage zusammengetragen, unter anderem eben auch über die Nahrung der Igel.
Aromatische Kräuter – allen voran der Thymian (Thymus) – werden oft und gern als Schneckenabwehrpflanzen angegeben. Das wissen daher wir Gartler, aber wissen es auch die Schnecken, dass sie Kräuter nicht mögen? Nein, natürlich nicht, und Sie glauben gar nicht, wie viele Schnecken ich schon aus einem "Restaurant Thymian" und "Bistro Ysop" entfernt habe.
Was Sie konkret gegen Schnecken tun können
Die bei uns so trockenen Jahre 2018 bis 2020 (speziell Sommertrockenheit) haben den Schnecken nicht sonderlich gut gefallen, denn diese Tiere lieben Feuchtigkeit. Und sie sind dämmerungs- und nachtaktiv, nur manchmal treibt sie ein Regenschauer tagsüber aus ihren Verstecken. Diese Vorlieben können wir uns zunutze machen:

Schneckeneier
- Legen Sie Bretter aus, unter die sich die Nacktschnecken tagsüber verkriechen und leicht abgesammelt werden können.
- Machen Sie früh am Morgen oder abends in der Dämmerung (wenn es kurz vorher geregnet hat, umso besser) einen Gang durch den Garten und sammeln Sie Nacktschnecken ein.
- Klauben Sie tagsüber die Schnecken aus ihren Tagesverstecken: Im Staudengarten werden Nepeta x faassenii (Blauminze), Arabis caucasica (Kaukasische Gänsekresse), Geranium macrorrhizum (Balkan- bzw. Felsen-Storchschnabel) sowie die großen, auf dem Boden aufliegenden Blätter einiger Verbascum-Arten (Königskerzen) zum Beispiel gern genutzt. Die favorisierten Verstecke in Stauden variieren je nach Jahreszeit und sind zudem von Jahr zu Jahr etwas anders.
- Beseitigen Sie gleich die Eigelege der Nacktschnecken, wenn Ihnen die kleinen weißen bis gelblichen, fast durchsichtigen Kügelchen bei der Gartenarbeit begegnen. (Nacktschnecken-Eier sind etwas kleiner als die der Weinbergschnecken. Den Unterschied zwischen beiden zu erkennen, ist schwierig und letztlich auch oft Gefühlssache).

Tigerschnegel
Das größte Problem ist, festzustellen, um welche Schnecken es sich handelt, die da den Weg entlangkriechen, denn manche Arten sehen sich so ähnlich, dass selbst Experten sie mit bloßem Auge nicht auseinanderhalten können. Die Rote Wegschnecke und die Gewöhnliche bzw. Spanische Wegschnecke zum Beispiel sind ohne Autopsie gar nicht zu unterscheiden, doch nur die Spanische bzw. Gewöhnliche ist ein unersättlicher Gartenschädling. Wenigstens können Sie so aber sicherstellen, dass keine Weinbergschnecken und andere Gehäuseschnecken unnötig ihr Leben lassen müssen.

Jungtier der Spanischen Wegschnecke
Ich für meinen Teil lasse inzwischen beispielsweise auch die Schnegel ihrer Wege ziehen, die kann man recht gut erkennen am sogenannten Kiel, der sich etwa von der Mitte des Rückens bis zur Schwanzspitze zieht; dieser Kiel fehlt den Wegschnecken, sie haben einen runden Rücken. Und ich freue mich, wenn ich ein Jungtier der Spanierin am dunkleren Streifen auf dem Rücken identifizieren kann, dann greife ich ohne schlechtes Gewissen zu.
Wie Sie (Nackt-)Schnecken final beseitigen

(vermutlich Spanische) Wegschnecken – Paarung
Was macht man eigentlich mit Schnecken, die man von allerlei Pflanzen oder Wegen absammelt? Wie wird man sie endgültig los? Müsste mir einfallen, sie in den Wald zu fahren, auszusetzen und das ökologische Gleichgewicht noch mehr durcheinanderzubringen! Wir überbrühen die Schnecken in einem Eimer mit kochendem Wasser; das ist schnell (für die Schnecken) und sicher (für uns). Die unappetitlichen Überreste können abgekühlt auf dem Kompost entsorgt werden oder in einer Gartenecke (bitte merken!).

(vermutlich Spanische) Wegschnecke – Kopf
Wenn man nicht gerade mit einem Eimer gezielt auf "Schneckenjagd" geht, ist als Alternative zum Absammeln das Zerschneiden der Schnecken möglich. Aber bitte nicht in der Mitte, sondern direkt hinter dem Kopf. Dieses "guillotinieren" verhilft den Schnecken zu einem schnellen Tod. Tote Schnecken sollten aus Beeten entfernt und aufs Gras oder auf Wege befördert werden (halt dahin, wo für Schneckengaumen sonst nichts Feines steht), denn die Kadaver locken tatsächlich andere Schnecken zum Festmahl an. Sehr praktisch, denn dabei sind sie leichte Beute für uns Schneckenjäger (und abgelenkt von unseren Pflanzenschätzen).
Wie Erfolg versprechend sind eigentlich die viel gepriesenen Bierfallen? Nach meiner Erfahrung locken Bierfallen kaum Schnecken an, schon gar nicht aus einem Umkreis von 50 Meter. Mit dem sardischen Bier, das ich bei meinen Versuchen verwendet habe, können meine Misserfolge doch nichts zu tun haben, oder? Ganz im Ernst: Vielleicht waren es zehn Schnecken in einer Bierfalle, mehr aber auch nicht. Das Gros der Schnecken hat den Biergeruch ignoriert und ist (auch unmittelbar) an den im Erdboden eingesenkten Fallen vorbeigezogen zu Besserem. Bierfallen lohnen sich also nicht (zumindest nicht bei mir). Weitere Nachteile der Bierfallen-Methode: Der Tod durch Ertrinken dürfte selbst für Schnecken qualvoll sein, und eventueller Bierdurst ist nicht auf die drei Nacktschnecken-Arten beschränkt, die den größten Schaden im Garten anrichten.
Zart besaitet darf man nicht sein, wenn man seine Gartenlieblinge wirkungsvoll gegen Schnecken verteidigen will. Aber hemmungslos ebenfalls nicht. Am besten: so zwischendrin.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Weiße Fliege
Im geschützten Kleinklima von Gewächshäusern, doch auch in windgeschützten Ecken im Freiland bringt uns so manches Jahr die Weiße Fliege bzw. Mottenschildlaus zur Weißglut. Sie vermehrt sich bei Temperaturen ab 18 °C rasend schnell. Übersehen können wir die Mottenschildlaus nicht, denn bei der kleinsten Berührung der befallenen Pflanzen fliegt meist ein ganzer Pulk der kleinen weißen Tierchen auf. Der eigentliche Schaden, den die Mottenschildlaus anrichtet, ist ähnlich dem, den Blattläuse verursachen.
Im Ziergarten tritt die Weiße Fliege eher selten auf, dafür im Gemüsegarten sowie in Gewächshäusern umso öfter. Besonders oft ist sie im Freiland-Nutzgarten an Kohlgewächsen zu finden (speziell an Rosenkohl) im Treibhaus an Tomaten-, Gurken- und Basilikumflanzen.
Um die Weiße Fliege loszuwerden, hat sich in meinem Garten die chemische Keule nicht bewährt. Bessere Ergebnisse erziele ich mit Paraffinöl-Spritzungen (obwohl Paraffinöl es eigentlich nur an hartlaubigen Pflanzen wie etwa Lorbeer eingesetzt werden soll). Es tötet die erwachsenen Tiere, die Larven sowie die Eier ab. Empfehlenswert ist bei starkem Befall mehrmaliges Spritzen der ganzen Pflanzen. Oder noch besser: Tauchen Sie wenn möglich die betroffenen Pflanzen in die Paraffinöl-Mischung. Bis zum völligen Abtrocknen sollten Sie die behandelten Pflanzen nicht direkt der Sonne aussetzen (Brennglaseffekt!). Schreiten Sie deshalb bevorzugt an trüben Tagen zur Tat. Solche Spritzungen mit Paraffinöl können Sie auch im Nutzgarten vornehmen; ob zwischen der Anwendung des Mittels und dem Verzehr der Nutzpflanzen eine Wartezeit erforderlich ist, entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben auf der Verpackung des Mittels.

Weiße Fliege
Der Nachteil beim Einsatz von Paraffinöl: Werden beim Spritzen Nützlinge getroffen, sieht's für die gar nicht gut aus. Vielleicht genügt zumindest in kleineren Gewächshäusern ja auch schon eine Mischkultur mit Selleriepflanzen, um die Weiße Fliege von Tomaten, Gurken und Basilikum abzuhalten. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht – ganz ohne negative Begleiterscheinungen und mit doppeltem Nutzen!
Von den viel gepriesenen Gelbtafeln oder ‑stickern halte ich wenig. Natürlich habe ich sie ausprobiert, doch was am seltensten daran kleben blieb, waren Weiße Fliegen. Aus ökologischer Sicht also völlig kontraproduktiv.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
Eine wirksame "Medizin" gegen Wühlmäuse, mit der man ganze Populationen erwischt, muss wohl erst noch erfunden werden. Wobei es einerlei ist, ob Sie es mit Feld-
 Unser Kater Balou mühte sich redlich, der Invasion Herr zu werden, doch bei der Vermehrungsrate (Beispiel Feldmaus: 5‑7 Würfe pro Jahr mit jeweils 4‑8 Jungen) nur mit mäßigem Erfolg; mit sehr mäßigem. Erfolgreicher waren und sind da die natürlichen Fressfeinde der Mäuse, als da wären: Storch, Raubvögel, Mauswiesel und mit großem Appetit allen voran der Igel. Der Eichelhäher macht Boden gut, wenn er ab und zu mal mit einer Maus davonfliegt; das hat er auch bitter nötig, räubert er während der Brutzeit doch die Nester unserer Singvögel und erbeutet Eier und Jungvögel.
Unser Kater Balou mühte sich redlich, der Invasion Herr zu werden, doch bei der Vermehrungsrate (Beispiel Feldmaus: 5‑7 Würfe pro Jahr mit jeweils 4‑8 Jungen) nur mit mäßigem Erfolg; mit sehr mäßigem. Erfolgreicher waren und sind da die natürlichen Fressfeinde der Mäuse, als da wären: Storch, Raubvögel, Mauswiesel und mit großem Appetit allen voran der Igel. Der Eichelhäher macht Boden gut, wenn er ab und zu mal mit einer Maus davonfliegt; das hat er auch bitter nötig, räubert er während der Brutzeit doch die Nester unserer Singvögel und erbeutet Eier und Jungvögel.

Eichelhäher
Falls Kater oder Katze nicht genügen oder einfach keine Lust haben und nicht ausreichend natürliche Fressfeinde zugegen sind: Das optimale Mittel, um Wühlmäuse zu dezimieren, sind immer noch Schlagfallen (alternativ: Lebendfallen – und wohin dann mit der Maus?). Diese Fallen müssen natürlich regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls geleert werden. Man platziert sie am besten (Handschuhe anziehen wegen der Geruchsübertragung) an frequentierten Stellen, also neben bzw. in frischen Gängen oder an "Rennstrecken". Als Lockmittel funktioniert – sofern es nicht zu warm ist – Vollmilchschokolade recht gut; es muss auch keine Edelmarke sein. In solchen Fallen getötete Mäuse werden zugedeckt auf dem Kompost im Garten oder in einer fest verschlossenen Plastiktüte im Restmüll entsorgt. Oder sie legen sie an eine exponierte Stelle im Garten und machen den Elstern eine Freude, die sich den Leckerbissen normalerweise zügig holen.
Freistehende Fallen stellt man vielleicht unter umgedrehten Gemüsekisten aus Kunststoff (ersatzweise Karton, blöd natürlich, wenn's regnet) oder flachen Steinen mit ein paar Brettern darüber auf, damit andere Tiere nicht versehentlich in die Fallen tappen.
 Dieses Prozedere ist sicher nichts für zarte Gemüter, aber leider unerlässlich, spätestens dann, wenn die Mäuse am helllichten Tag über die Terrasse huschen. Im Zweifelsfall denken Sie einfach daran, wie Sie mit den Schnecken umgehen und versuchen zu vergessen, dass die Wühlmäuse einen kuscheligen Pelz haben und eigentlich ganz niedlich aussehen. (Hat man es mit den fast doppelt so großen Schermäusen zu tun, kommt dieses Mitgefühl seltener auf; die erinnern schon an Ratten.)
Dieses Prozedere ist sicher nichts für zarte Gemüter, aber leider unerlässlich, spätestens dann, wenn die Mäuse am helllichten Tag über die Terrasse huschen. Im Zweifelsfall denken Sie einfach daran, wie Sie mit den Schnecken umgehen und versuchen zu vergessen, dass die Wühlmäuse einen kuscheligen Pelz haben und eigentlich ganz niedlich aussehen. (Hat man es mit den fast doppelt so großen Schermäusen zu tun, kommt dieses Mitgefühl seltener auf; die erinnern schon an Ratten.)
Dass Wühlmäuse bestimmte Pflanzen beziehungsweise deren Wurzeln meiden, kann ich so nicht unterschreiben; Sie glauben gar nicht, was mir alles schon weggefressen wurde.
Im 19. Jahrhundert, als elektrische Signale zum Vertreiben der Wühlmäuse (besser: zum Versuch, sie zu vertreiben) erst noch erfunden werden wollten, war die Empfehlung, Löcher in den Boden zu bohren, um die Nager zu fangen. Über den genauen Ablauf dieser Maßnahme und die Folgen für die Tiere war man sich jedoch offenbar uneins. So heißt es im Handbuch der Landwirtschaft 1898 von J. A. Schlipf¹ im Kapitel über die "Abhaltung und Vertilgung schädlicher Tiere" auf Seite 112:

Nicht immer interessieren sich Katzen für Mäuse
"Unter den schädlichen Tieren, zu deren Vertilgung der Landwirt genötigt ist, sind von den vierfüßigen Tieren vor allem die Feldmäuse zu erwähnen. Dieselben können durch Fanggruben, welche man mit dem Erdbohrer 30 bis 40 cm tief macht und an den Kreuzgängen der Mäuse anlegt, vertilgt werden. Die Mäuse müssen aber den Tag über in der Grube getötet werden, weil sie sich bei einem längeren Aufenthalt darin leicht einen Ausgang verschaffen."
Dr. Gustav Jäger dagegen schreibt in seinem zweibändigen, heute noch aufschlussreichen Werk "Deutschlands Thierwelt"² ein Vierteljahrhundert vorher (1874) im ersten Band auf Seite 94 zu den Feldmäusen unter anderem:
"Als das beste Mittel gegen die Mäuse hat sich der Mäusebohrer erwiesen, ein Instrument, mit dem etwa 10 bis 15 cm. weite, 60 cm. tiefe Löcher mit glatten Wänden in den Boden getrieben werden. Die hineingestürzten Mäuse machen merkwürdiger Weise keinen Versuch sich herauszugraben, und sobald mehrere darin sind, fressen sie sich auf."
Ja, das waren halt noch Zeiten, als einem eine in Breslau ansässige Düngerfabrik das Dutzend "erlegter" Feldmäuse für einen Pfennig abnahm (im Jahr 1856 war das), wie Gustav Jäger in diesem Kapitel weiter schreibt. In guten Feldmaus-Jahren könnte das doch fast lukrativer sein als das Einsammeln von E‑Scootern …
¹ Handbuch der Landwirtschaft von Johann Adam Schlipf, Nachdruck der Originalausgaben von 1898 und 1958 in einem Band, herausgegeben von Manuscriptum Verlagsbuchhandlung Waltrop und Leipzig 2002, ISBN 3-933497-77-9
² Deutschlands Thierwelt nach ihren Standorten eingetheilt von D. Gustav Jäger, Verlag von U. Kröner, Stuttgart 1874 (nur noch antiquarisch erhältlich, wenn überhaupt)
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
 Engerlinge! Dieser Ausruf sorgte in meiner Kindheit nahezu für Panik unter allen benachbarten Gartlern, war doch "Engerling" praktisch ausschließlich das Synonym für die Larven von Mai- und Junikäfern, die als große Blattschädlinge galten. Früher, das war aber die Zeit, in der uns das Brummen der Maikäfer (Melolontha melolontha) und Junikäfer (Amphimallon solstitiale) während der Frühsommermonate allabendlich begleitet hat und ihre Fraßschäden an Laubbäumen erst bei Tageslicht sichtbar wurden.
Engerlinge! Dieser Ausruf sorgte in meiner Kindheit nahezu für Panik unter allen benachbarten Gartlern, war doch "Engerling" praktisch ausschließlich das Synonym für die Larven von Mai- und Junikäfern, die als große Blattschädlinge galten. Früher, das war aber die Zeit, in der uns das Brummen der Maikäfer (Melolontha melolontha) und Junikäfer (Amphimallon solstitiale) während der Frühsommermonate allabendlich begleitet hat und ihre Fraßschäden an Laubbäumen erst bei Tageslicht sichtbar wurden.
Heute brummt es an Mai- und Juniabenden nur noch verhalten; zumindest bei uns. Und Fraßschäden sehen wir gar nicht. Grund dafür ist die chemische Keule, die nicht nur in der Landwirtschaft gegen die Käfer und ihre Larven geschwungen wurde und wird. Die war zunächst natürlich ein Segen, denn die Engerlinge gehörten bis weit ins 20. Jahrhundert zu den größten Schädlingen im Ackerbau, und bis zu ihrer Erfindung mussten sich die Landwirte mit mechanischen Bekämpfungsmethoden behelfen. So ist im "Schlipf"¹, dem Handbuch der Landwirtschaft 1958, im Kapitel über "Pflanzenbau – Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Schädlinge und Pflanzenkrankheiten" auf Seite 127 zu lesen:
"In jedem Fall soll man alle Insektenfresser pflegen oder schonen, wie Igel, Krähen und vor allem die insektenfressenden Vögel … vor allem aber die Hühner, die im fahrbaren Hühnerwagen auf das Feld gebracht werden können. Dieselben Mittel sind auch anwendbar gegen die Mai- und Junikäfer und deren Larven, die Engerlinge."
Was in unseren Tagen von den Medien gelobt und gefeiert wird – der fahrbare Hühnerwagen bzw. Hühner in Ackerkulturen – wie eine bahnbrechende Neuerfindung, ist tatsächlich ein alter Hut: vergessenes (oder von den Landwirtschaftsschulen vergessen gemacht wordenes) Fachwissen der Bauern.
Nicht nur die Larven von Mai- und Junikäfern heißen allerdings Engerlinge. Es gibt auch noch einige andere Käfer mit ähnlichen, für einen Laien schwer zu unterscheidenden Larven: Hirschkäfer (Lucanus cervus), Nashornkäfer (Oryctes nasicornis), Rosenkäfer (z. B. Cetonia aurata, der Gold-Rosenkäfer) etc.

Gold-Rosenkäfer in Alcea-rugosa-Blüte
Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass Engerlinge im Kompost oder in abgestorbenem Holz zu den "Guten" gehören und der Nachwuchs zum Beispiel vom Nashornkäfer (ernährt sich von verrottendem Holz) oder vom Rosenkäfer (lebt von organischem Material aller Art) sind.
Deshalb meine Bitte: Greifen Sie nur ein, wenn Sie an Pflanzenwurzeln sehr viele Engerlinge finden. Am sinnvollsten ist dann eine mechanische Bekämpfung durch Um-/
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Amsel-Mann mit Futter
Wer am Morgen den Garten betritt und die am Vortag liebevoll gepflanzten neuen Setzlinge (vorzugsweise von Gemüsepflanzen) nicht mehr findet, sollte sich umsehen, ob nicht vielleicht ein rundgefressener Spatz (Sperling) zwischen den Beeten liegt und genüsslich verdaut. Vor allem junge Salatpflanzen sind für Spatzen eine Delikatesse und werden zerrupft, bis auch das letzte zarte Blättchen gepickt ist. Nicht alles können wir also den Schnecken und den Wühlmäusen in die Schuhe schieben – es gibt noch andere Rabauken, die im Garten ganze Arbeit leisten!

Spatzen-Dame (Haussperling)
Amseln picken an jungen Pflänzchen zwar auch, ihre Spezialität ist aber eher, die Setzlinge aus der frisch gelockerten Erde zu ziehen, um an Würmer und Larven zu gelangen. Frische Pflanzungen sollten wir daher gut im Blick haben, um schnell handeln und die Pflanzen wieder ins Erdreich drücken zu können, denn die Wurzeln trocknen blitzschnell aus.
Der beste Schutz gegen solchen Vandalismus sind Vogelschutznetze. Oder Pflanzglocken, die zwei weitere Vorteile bieten:
- Sie schützen auch vor Schnecken
- Sie sorgen für ein tolles Kleinklima, bieten Schutz in kühlen Nächten und erleichtern so das Anwachsen der Pflanzen (bei Sonnenschein sollten Sie allerdings vorsorglich kontrollieren und die Hauben gegebenenfalls vorübergehend entfernen, damit die Pflanzen nicht im eigenen Saft schmoren)

Solche Pflanzglocken oder ‑hauben gibt es als Billigversion aus Plastik sowie als Edelvariante aus Glas. Zumindest in größeren Gärten dürfte da die Optik dem Preis zum Opfer fallen.
Immerhin: Amseln machen mit so manchem Nacktschnecken-Mahl den Ärger wegen ausgezupfter Pflänzchen einigermaßen wett. Spannend zu beobachten ist, wie Mama oder Papa Amsel eine Nacktschnecke immer wieder auf harten Untergrund donnern (vermutlich, damit sie ihren Schleim absondern), ehe sie an den Nachwuchs verfüttert wird.
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
Afterraupen – Maiglöckchen- bzw. Salomonssiegel-Blattwespe
Wenn im Garten plötzlich Skelette stehen
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Afterraupen an Polygonatum (Salomonssiegel)
Sehr schade, dass nicht nur wir Gärtner das Salomonssiegel (Polygonatum) lieben, sondern auch die Schnecken und die Afterraupen der Maiglöckchen- bzw. Salomonssiegel-Blattwespe – Phymatocera aterrima. (Die Larven diverser Pflanzenwespen werden Afterraupen genannt wegen ihrer besonderen Anatomie und Ähnlichkeit mit Raupen der Falter.)
Bemerkt man einen Befall mit den Afterraupen auch nur etwas zu spät und sind es zu viele, um sie abzusammeln, kann man seine Maiglöckchen und Salomonssiegel für dieses Gartenjahr optisch vergessen. Außer man greift zur Giftspritze (Spruzit hat sich als Insektizid bewährt und ist noch das ungiftigste von allen …), das lohnt sich jedoch auch nur dann, wenn die Raupen noch nicht zu viel Schaden angerichtet und die Pflanzen bis aufs Gerippe abgenagt haben.

Polygonatum-Gerippe nach Afterraupenfraß
Die Maiglöckchen- oder Salomonssiegel-Blattwespe sucht unsere Gärten mit nur einer Generation im Jahr heim. Sobald sich die Raupen von Phymatocera aterrima vollgefressen haben, ziehen sie sich im Juni/

Polygonatum 'Weihenstephan'
Absammeln und vernichten? Das hilft dem Gärtner weiter und spart wenigstens den Einsatz von Insektiziden. Absammeln und in der Natur aussetzen? Das wäre optimal, nützt den Afterraupen und damit der neuen Generation der Blattwespe jedoch nur, sofern sie zu natürlichen Beständen von Maiglöckchen oder Salomonssiegeln gebracht werden. Dazu muss man sich schon ein wenig auskennen in der Region.
Als kleine Entscheidungshilfe und der Fairness den Pflanzenwespen und den Afterraupen gegenüber will ich noch anmerken, dass unser Polygonatum die Afterraupen-Attacke nicht weiter kummgenommen und gut verkraftet hat. Im darauffolgenden Jahr stand es üppig wie eh und je an seinem Platz.
Brauner Mönch, Königskerzen-Mönch (Cucullia verbasci)
Nicht jedes Jahr richten die Raupen dieses Falters Schaden an
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Raupen auf Verbascum chaixii
Mit nur einer Generation pro Jahr ist der Braune Mönch (Cucullia bzw. Sharagacucullia verbasci) unterwegs, doch das genügt seinen Raupen völlig, den Königskerzen im Juni/

Verbascum phoeniceum 'Violetta'
Ganz anders die bis 5 cm langen Raupen des Falters, die auffällig gelb und schwarz gezeichnet in aller Seelenruhe und tagsüber ihre Aufgaben erledigen: zunehmen und wachsen. Meist sind es nicht viele pro Pflanze, denn die Weibchen des Falters achten darauf, dass ihre Eier gut verteilt sind, damit den daraus schlüpfenden Raupen auch wirklich ausreichend Futter zur Verfügung steht. Da das Laub die erste Fraß-Wahl ist, hält sich der Schaden, den sie dabei anrichten, auf reich beblätterten Königskerzen-Arten wie Verbascum chaixii (Chaix′ oder Französische Königskerze) in Grenzen. Auf Arten mit grundständigen Blattrosetten und wenig Laub wie Verbascum phoeniceum (Purpur-Königskerze, Purpurrotes Wollkraut) hingegen fallen ihnen die Knospen zum Opfer und das heißt, auf die Blüte mehr oder minder verzichten zu müssen.

Raupe des Braunen Mönchs
Absammeln und die Raupen in der Natur aussetzen, sowie man sie bemerkt, ist sicher die beste Lösung. Das Problem dabei: Kennen Sie in der Umgebung Ihres Gartens noch "wilde" Königskerzen? Bei mir in der Nähe gibt es keine mehr. Die besten Chancen hat man vermutlich in dicht besiedelten Gebieten mit Brachen zwischendrin. Eine Alternative zu Königskerzen bietet Scrophularia nodosum, die Knotige Braunwurz, die in Deutschland noch flächendeckend natürlich vorkommen soll.

Verbascum chaixii 'Album'
Wer sich darüber keine Gedanken macht und einfach nur seine Königskerzen retten will, der kann zu einem Raupen-Spritzmittel greifen. Bacillus thuringiensis ist heutzutage das Gängigste, was im Privatgarten eingesetzt wird. Das ist zwar ein biologisches Mittel, doch Vorsicht: Dieser Bacillus tötet alle Raupen, auf die er in ausreichender Menge trifft! Deshalb sollte es möglichst windstill sein, wenn man loslegt. Dieser Wirkstoff muss zudem schon mal mehrfach angewendet werden, um die Raupen auch wirklich "dranzukriegen". Absammeln geht da schneller und kann bei jedem Wetter praktiziert werden.
Diese Möglichkeiten bleiben, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man kann es auch gar nicht erst so weit kommen lassen: Ab Mai ist der Königskerzen-Mönch unterwegs und die Weibchen heften ihre Eier an die Unterseite von Verbascum-Blättern. Daraufhin können die Königskerzen kontrolliert und mit Eiern behaftete Blätter abgeschnitten sowie im Restmüll entsorgt werden.
Am allerbesten wäre es freilich, sich einen Ruck zu geben und den Dingen – der Natur – ihren Lauf zu lassen. Mehrjährigen Königskerzen gelingt es nämlich fast immer, sich nach solch einer Raupen-Tortur zu berappeln, wenn auch erst im Folgejahr so richtig. Der Befall mit den Raupen des Königskerzenmönchs unterliegt zudem starken Schwankungen; in manchen Jahren tauchen gar keine Raupen auf.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Blattschäden durch die Johannisbeer-Blasenlaus
Wenn sich das satt dunkelgrüne Laub der Johannisbeer-Sträucher plötzlich teilweise hellgrün, gelblich oder rotbraun verfärbt und sich auf den Blättern blasige Ausbuchtungen nach oben wölben, steckt die Johannisbeer-Blasenlaus dahinter. Die Weibchen dieser Blattlaus-Art legen im Herbst Eier an Johannisbeer-Triebe, aus denen im Frühjahr mit dem Blattaustrieb der Pflanzen die erste Lausgeneration des Jahres schlüpft. Die Läuse ernähren sich vom Pflanzensaft, wozu sie die Blätter anstechen, die darauf wiederum mit den Auswüchsen auf den Blattoberseiten reagieren. Die Läuse selbst halten sich in der Regel auf den Blattunterseiten auf und vermehren sich munter weiter.

Johannisbeer-Blasenlaus an Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Auf gesunde und nicht geschwächte (durch Nährstoffmangel und oder Trockenheit beispielsweise) Pflanzen hat der Blattlaus-Befall kaum Auswirkungen; der Befall muss schon sehr stark sein, damit die Johannisbeer-Pflanzen Schaden nehmen, weil sich kaum noch gesunde Triebe entwickeln können.
Die sekundären Auswirkungen des Läusebefalls sind da fast gefährlicher für die Pflanzen: Blattläuse können Viren übertragen und so sogenanntnannte Virosen verursachen. Auf den klebrig-süßen Ausscheidungen der Blattläuse (Honigtau genannt) siedeln sich zudem leicht Schwärze- bzw. Rußtaupilze an, unter denen den Pflanzen keine Fotosynthese mehr möglich ist. Bei sehr starkem Befall können die Pflanzen auch daran eingehen.

Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyrides) an Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Den Antagonisten der Blattläuse gelingt es in der Regel, die Tierchen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Freuen Sie sich deshalb, wenn Sie zum Beispiel Marienkäfer (auch die fremdländischen Asiatischen Marienkäfer) und deren Larven sehen, denn sie verdrücken reichlich Blattläuse. Schützen Sie Florfliegen, weil deren Larven ebenfalls auf Blattlausjagd gehen. Die Larven etlicher Schwebfliegen-Arten tun es ihnen gleich.
Wem die Aussicht auf Hilfe durch diese Nützlinge zu vage ist, der kann im zeitigen Frühjahr bzw. bereits im Spätwinter mit Paraffinöl schon gegen die Läuse-Eier spritzen und – falls erforderlich – später im Jahr gegen die Läuse mit Mitteln, die Kaliseife enthalten. (Die Firma Neudorf hat beide Präparate im Sortiment.)

Ribes-alpinum-Hecke – Alpen-Johannisbeere
Betroffene Blätter bei übersichtlichem Befall abzuzupfen und samt der darauf lebenden Läuse zu entsorgen, ist gerade bei Johannisbeer-Sträuchern, deren Früchte man essen möchte, sicher die beste Lösung; zumal wenn Nützlinge rar sind. Und Sie können es den Läusen unbequemer machen, indem Sie darauf achten, dass der Stickstoffgehalt im Boden nicht zu hoch ist. Viel Stickstoff bedeutet nämlich weicheres Pflanzengewebe, und das spielt den Läusen in die Hände; an festerem Gewebe tun sie sich schwerer mit dem Anstechen.

Vierzehnpunkt-Marienkäfer paaren sich auf Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Noch kurz zurück zur Biologie der Johannisbeer-Blasenlaus: Im Sommer verlassen diese Läuse (eine geflügelte Generation) die Johannisbeeren und suchen sich einen neuen Wirt unter Stauden aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae), zum Beispiel Salbei-Arten (Salvia) oder Gamander-Arten (Teucrium). Erst im Herbst kehren befruchtete Läuse-Weibchen zu den Ribes-Pflanzen zurück, um Eier abzulegen, die an den Trieben den Winter überdauern, ehe im Frühling das Spiel von Neuem beginnt.
Nicht dass Sie jetzt denken, Johannisbeeren seien im Sommer blattlausfreie Zone – da rücken schon andere Arten aus der großen, über 800 Arten umfassenden Blattlausgattung nach!
Kohlweißlinge (Pieris brassicae und Pieris rapae)
Heutzutage ist der Kleine der große und der Große der kleine Schädling

Kleiner Kohlweißling auf Cephalaria gigantea
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Großer Kohlweißling auf Abelia mosanensis
So hübsch diese beiden Schmetterlinge anzusehen sind, wenn sie durch den Garten tanzen und immer wieder auf Blüten rasten, um Nektar zu tanken (besonders gern von Lavendel – Lavandula angustifolia), so übel sind im Gemüsegarten an Kohlpflanzen aller Art die Hinterlassenschaften und Fraßschäden ihrer Raupen. Löcher in Kohlblättern könnten natürlich von Schneckenfraß ebenso herrühren, doch falls Schleimspuren fehlen und die Kotrückstände die Form kleiner Kügelchen haben, hat man's so gut wie immer mit Falterraupen, meist eben vom Großen (Pieris brassicae) und/
Der größere von beiden Faltern (vom kleineren anhand der ausgedehnteren Schwarzfärbung an den "Spitzen" der Vorderflügel zu unterscheiden), war früher der weitaus häufigere, inzwischen ist er in den meisten Regionen viel seltener geworden als der kleinere (insgesamt betrachtet sind heute alle zwei nicht mehr in Massen anzutreffen).

Kleiner Kohlweißling – Eier auf Kohlrabiblatt
Diese beiden Weißlings-Arten treten in zwei Generationen pro Jahr auf. Die erste davon legt ihre Eier im April und im Mai, die sich aus diesen Eiern entwickelnden Schmetterlinge legen im Hochsommer Eier. Fehlen zur Zeit der ersten Eiablage geeignete Raupenfutterpflanzen (neben Kohlgewächsen auch Kapuzinerkresse – Tropaeolum – und Reseden – Reseda lutea) im Garten, bremst sie das schon ganz schön aus. Späteres Auspflanzen ist also eine geeignete Methode der Schadensbegrenzung. Der zweiten Generation können dann fernab vom Gemüsegarten Kapuzinerkresse und Reseden angeboten werden, was jedoch als Ablenkungsmanöver von den Krautpflanzen nicht immer funktioniert.
Im Hochsommer sollten deshalb die Blattunterseiten von Kohlgewächsen regelmäßig auf angeheftete Falter-Eier kontrolliert werden: Die Weibchen des Kleinen Kohlweißlings (Pieris rapae) pappen sie vereinzelt an die Blätter, die des Großen Kohlweißlings (Pieris brassicae) zu vielen nebeneinander. Wenn Sie solche Blätter oder auch nur die Eigelege gleich entfernen, bleiben Ihnen die Raupen erspart, bis auf diejenigen, die aus übersehenen Eiern geschlüpft sind.

Kleiner Kohlweißling – Raupe
Es empfiehlt sich also, die Kohlpflanzen weiterhin im Auge zu behalten, um eventuelle Raupen zeitnah einsammeln zu können. Das ist vor allem beim Kleinen Kohlweißling nicht ganz einfach, dessen Raupen sich gern ins Innere von Krautsköpfen fressen und die zudem mit ihrer einheitlich grünen Färbung gut getarnt und schwer zu entdecken sind. Wohin dann mit den Raupen? Ich verfrachte sie – meist mit dem Kohlblatt, auf dem sie sitzen – auf den Kompost. Entweder sie sind schon groß genug und kommen durch oder nicht.

Gammaeule auf Lavandula angustifolia
Kohlweißlingsraupen sind nicht die einzigen, die sich an Kohlgewächsen gütlich tun. Mit Autographa gamma (Gammaeule), Mamestra brassicae (Kohleule) und Peridroma saucia (ohne deutschen Namen) haben wir noch drei weitere Falterarten, deren Raupen Kohl als Futterpflanzen nutzen. Zumindest die Raupen von Peridroma fressen nachts, es lohnt sich also, auch mal im Dunkeln mit Taschenlampe einen Kontrollgang zu machen.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Lilienhähnchen
Keine Lilie ohne Lilienhähnchen, keine Lilienhähnchen ohne Lilien? Das stimmt nicht ganz, denn leider fressen die Larven dieses auffälligen kleinen Käfers aus der Familie der Blattkäfer (Chrysomelidae) nicht nur Lilien, sondern mit großem Appetit auch an anderen Zwiebel- und Knollengewächsen (Kaiserkronen und Schachbrettblumen – beide aus der Gattung Fritillaria –, Gemüsezwiebeln und Schnittlauch – Gattung Allium – zum Beispiel).
Die nicht mal einen Zentimeter großen, schwarzen Käfer mit den leuchtend roten Flügeldecken wären nicht das Problem; ihre Fraßschäden sind zu verkraften. Das größere Übel sind die Larven, die ab dem späten Frühling (drei Generationen gibt es vom Lilienhähnchen pro Jahr) schlüpfen und in Massen auftreten können. Von mancher Pflanze steht am Ende ihrer Fressorgie kaum noch etwas.

Mit ihrem Kot bedeckte Larve des Lilienhähnchens
Wer sich aufzuraffen vermag (mit Handschuhen), die Larven abzusammeln (von den Pflanzen schütteln und aufklauben geht ebenfalls), kann sie auf dem Kompost entsorgen. Doch die Larven absammeln und vernichten, macht man äußerst ungern, weil sie sich über und über mit ihrem Kot bedecken, um unbehelligt zu bleiben. Zum einen sind sie dadurch schwieriger zu entdecken, zum anderen schützt sie der Ekel-Effekt. Vögel, Igel, Spitzmäuse und Raubkäfer – ihre natürlichen Fraßfeinde – schlagen auch nur zu, wenn sie eine Larve finden, bevor sie sich "kostümiert und einparfümiert". Insektizide wie Spruzit, das ansonsten gegen allerlei Maden und Larven vernichtend wirkt, perlt an diesen Larven ab und kann die "Schutzschicht" nicht durchdringen.

Larve des Lilienhähnchens
Besser ist es also beim Lilienhähnchen, schon vorher anzusetzen und die Käfer zu dezimieren, sprich von den Pflanzen abzusammeln. Vom Spätherbst bis zum Frühjahr ziehen sich die Käfer zur Überwinterung in die Erde zurück und tauchen manchmal bei der Bodenbearbeitung auf. Auch dann sollte man zugreifen (und drauftreten).
Neben Fraßfeinden haben die Larven und die Eier noch eine Reihe von Gegenspielern wie Schlupfwespen, Erzwespen und Zwergwespen, die Eier oder Larven parasitieren und damit vernichten. Feldwespen schleppen zudem die Larven als Nahrung für den Nachwuchs nach Hause.

Rosmarinus officinalis – Rosmarin
Mein Tipp, um Lilienhähnchen gar nicht erst loswerden zu müssen, ist, sie gleich vom Einzug in den Garten abzuhalten. Das gelingt mit Rosmarin wunderbar: Gefährdete Pflanzen werden – zumindest bei uns im Garten ist das so – neben Rosmarin (Rosmarinus officinalis) nicht vom Lilienhähnchen und dessen Larven befallen. (Ob der Rosmarinduft den Geruch von Lilien und anderen Zwiebel- und Knollengewächsen überlagert oder ob Käfer und Larven den Geruch von Rosmarin nicht mögen, muss dahingestellt bleiben.) Schade nur, dass Rosmarinus officinalis für die Freilandkultur in Deutschland in den meisten Regionen nicht winterhart genug ist (zumindest nicht auf Dauer). Funktioniert der Abwehrmechanismus bei Topfkultur von Rosmarin ebenfalls? – Das müsste man halt ausprobieren.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Podagrica fuscicornis auf Alcea rugosa
Malven-Erdflöhe (Podagrica) treiben mit drei sehr ähnlichen, jedoch gut zu unterscheidenden Arten ihr Unwesen an Malvengewächsen wie Stockrosen (Alcea) und Eibisch (Althaea). Zwei davon sind in Deutschland anzutreffen (der Dunkelköpfige Malven-Erdfloh – Podagrica malvae – fehlt): Der Schwarzbeinige (Podagrica fuscipes) kommt nur in wärmeren Gegenden vor, der Gewöhnliche Malven-Erdfloh (Podagrica fuscicornis) praktisch flächendeckend. Hauptsächliches Erkennungsmerkmal sind tatsächlich die Beine, die beim einen schwarz, beim häufigen Gewöhnlichen Malven-Erdfloh rötlich sind.

Larvengang in Alcea-rugosa-Stängel
Die Malven-Erdflöhe sind trotz ihrer geringen Größe von gerade mal drei bis sechs Millimetern nicht zu übersehen, erst recht aber bemerken wir ihren Appetit, denn die Käfer durchlöchern die Blätter (weniger, aber auch die Blüten) ihrer Wirtspflanzen (Malvengewächse allgemein) wie ein Sieb. Meist werden die Blätter nicht bis aufs Gerippe abgenagt und es bleibt bei der rein optischen Beeinträchtigung, die aus einiger Distanz nicht weiter auffällt. Schlimmer sind da die Larven des Malvenfloh-Käfers, die sich vom Stängelmark und den Wurzeln ihres Wirts ernähren und die Pflanzen dadurch schwächen können.

Absammeln und vernichten lassen sich die (tagaktiven) flugfähigen und zudem springenden Käferchen nicht, es ist deshalb eine Frage der persönlichen Einstellung, ob in solchen Fällen Insektizide zum Einsatz kommen oder nicht. Sicher hängt solch eine Entscheidung aber auch davon ab, wie stark der Befall ist.
Die Malven-Erdflöhe schätzen einen sehr trockenen Stand ihrer Wirtspflanzen. In niederschlagsarmen Jahren wird es deshalb durch regelmäßiges Gießen schon ab dem Frühjahr etwas ungemütlicher für sie.

"Abgestürzter" Malven-Erdfloh im Pollenbad
Falls diese Sechsbeiner trotzdem ausgerechnet die Stockrosen und andere Malvengewächse im eigenen Garten mit Beschlag belegen, reduziert man vielleicht am besten die weitere Ausbreitung und macht es den Larven schwerer, indem man wenigstens die Stängel der betroffenen Pflanzen im Spätsommer abschneidet und in der Biotonne oder dem Restmüll entsorgt (auf den Kompost dürfen die Stängel in diesem Fall nicht).
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Schweizer Minze (Mentha)
Pfefferminze (Mentha) wächst normalerweise so schnell und so stark, dass nicht gleich die ganze Ernte in Gefahr ist, wenn ein paar Käfer daran partizipieren. Einzelne dieser Blattkäfer kann man also tolerieren, sie perforieren zwar etliche Blätter, aber was soll's.
Handlungsbedarf besteht meines Erachtens erst, wenn sich eine ganze Horde dieser Käfer auf der Minze tummelt und die Blätter nicht bloß perforiert, sondern größtenteils aufgefressen sind. Wem das zu kritisch ist, erst einmal abzuwarten, der sollte seine Pfefferminze radikal runterschneiden, sowie er die ersten Löcher und/

Minze-Blattkäfer (Chrysolina herbacea)
Insektizide sind zwar ebenfalls nicht jedermanns Sache, doch eine Option. Das Ergebnis ist zudem dasselbe: Am Ende sind die Käfer tot. Lassen Sie sich da am besten in der Pflanzenschutz-Abteilung eines Garten-Centers oder Baumarktes oder gleich in der Gärtnerei ihres Vertrauens beraten; ich hab damit keine Erfahrungen. Und halten Sie unbedingt die angegebene Wartezeit zwischen Anwendung des Mittels und Ernte ein (ist auf den Mitteln angegeben). Aber ob man die Minze trotz Wartezeit mit gutem Gefühl verarbeitet und zu sich nimmt, steht auf einem anderen Blatt. Hinzu kommt, dass nach so einer Spritzung zwar die Käfer tot vom Stängel fallen, die Eier, die die Weibchen bis dahin möglicherweise an die Blattunterseiten geheftet haben, bleiben aber weiterhin pappen. Vorsorglich sollten Sie also selbst die Ernte von "vorbehandelten" Mentha-Pflanzen "auf links drehen".

Minze-Blattkäfer (Chrysolina coerulans)
Wir halten es zumeist so, dass wir die Pfefferminze in großen Pflanztöpfen kultivieren (so lässt sich ihr Wuchern ebenfalls besser kontrollieren), die wir an verschiedenen Stellen im Garten platzieren. Meist bleibt einer davon (wenigstens weitgehend) verschont oder aber die Käfer lassen sich dauerhaft umsiedeln. In kleineren Gärten kann sich daraus natürlich ein Platzproblem ergeben. Dann ist tatsächlich der bodennahe Rückschnitt der Triebe (heruntergefallene Käfer nicht übersehen!) schon im Anfangsstadium die beste Lösung. Vielleicht gibt es ja sogar in der (weiteren) Umgebung des Gartens noch wilde Pfefferminzbestände?

Marokkanische Minze (Mentha)
Die Arten der sogenannten Minze-Blattkäfer sind schwer voneinander zu unterscheiden. Drei verschiedene haben wir recherchiert: Chrysolina herbacea, Chrysolina graminis und Chrysolina coerulescens. Mit zweien davon dürften wir es bei uns im Garten zu tun haben, ganz sicher ist die Bestimmung der Arten auf den Fotos allerdings nicht. Unterm Strich spielt das aber keine Rolle – nur das Ergebnis zählt. Mahlzeit!
Eines haben wir bei unseren Minze-Blattkäfern immer wieder beobachtet: Sie sind wählerisch. Wenn sie sich entscheiden können zwischen Marokkanischer Minze und Schweizer Minze, nehmen sie die Marokkanische. Immer. Sie fahren voll auf Kaugummi-Geschmack respektive Spearmint ab.
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Die Früchte des Pfaffenhütchens
Einheimische Pflanzen, so heißt es immer, sind elementar für den Arterhalt und die Vielfalt der Fauna. Und zwar nicht nur der Insekten, sondern aller Tiere. Und das Europäische Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) ist ein einheimisches Gehölz. Es verhält sich nur so, dass die Vögel in meinem Garten und der Umgebung recht wenig auf dererlei Erkenntnisse geben und sich wenig für die attraktiven Früchte des Euonymus europaeus interessieren. Deshalb fallen seine Samen bei mir Jahr für Jahr zu Hunderten zu Boden und verwandeln sich in Hunderte von Sämlingen.

Gespinst der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte
Falter schenken dem Pfaffenhütchen mehr Aufmerksamkeit und so sind die kleinen Bäume ab Mai mit schöner Regelmäßigkeit mit Gespinsten überzogen, in denen sich die Raupen der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte an den Blättern gütlich tun. Sehr starker Befall kann die Bäumchen natürlich schädigen oder in Einzelfällen sogar absterben lassen, doch meistens bleibt es (glücklicherweise) bei einer beeinträchtigten Optik. Pfaffenhütchen sind zäh und vertragen so einiges.

Pfaffenhütchen-Gespinstmotte
Sollte man also überhaupt etwas gegen diese Raupen unternehmen? Eher nicht, denn mit dem Einsatz von Spritzmitteln ist den Raupen nicht beizukommen; am dichten Gespinst perlen die Mittelchen ab. Vorbeugend Ende April mit dem (biologischen) Mittel "Bacillus thuringiensis" (erhältlich in der Giftecke der Gartencenter und Baumärkte mit Gartenabteilung, manchmal auch in Gärtnereien) gegen Raupen zu spritzen, wäre eine Alternative. Dagegen wende ich jedoch ein, dass dieser Bacillus thuringiensis nicht nur die Raupen der Gespinstmotten tötet, sondern alle Raupen an den damit behandelten Pflanzen, und es sind doch auch etliche andere Falter, deren Raupen Pfaffenhütchen als Futterpflanze benötigen (darunter der Pfaffenhütchen-Wellenrandspanner, Artiora evonymaria, der vom Aussterben bedroht ist).

Raupe der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte
Als Hausbaum wird kaum jemand ein Pfaffenhütchen wählen. Also stehen diese Bäumchen im Garten ohnehin nicht so sehr im Blickfeld, dass die Gespinste wirklich stören würden (sie fallen aus einiger Entfernung nicht mehr auf). Beim Bekämpfen der Gespinstmotten-Raupen kann man zudem die Vögel wieder brauchen: Bei mir sind es die Blaumeisen, die mit Hingabe und Akribie die Gespinstmotten-Raupen aus ihrer "Burg" pulen.
Die Familie der Gespinstmotten (Yponomeutidae) ist groß und andere Arten befallen andere Pflanzen. So können wir es im Hausgarten zum Beispiel mit der Zwetschgen-/
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Einer der schwarzen Spitzmausrüssler
Spitzmausrüssler (Familie der Apionidae) schätzen nette Gesellschaft und sind deshalb gern zusammen mit Malven-Erdflöhen auf Malvengewächsen unterwegs. Als erwachsene Tiere (Imagines bzw. Adulte) perforieren sie die Blätter ihrer Wirtspflanzen, als Larven schädigen sie deren Blattstiele, Stängel (das Stängelmark) oder Samen. Einige dieser Spitzmausrüssler auf Malven sind sich so ähnlich, dass Laien am Versuch scheitern, sie unterscheiden zu wollen. Das sind
- das Stirngruben-Malven-Spitzmäuschen (Aspidapion aeneum – ca. 2,9‑3,6 mm lang ohne Rüssel)
- das Gewöhnliche Malven-Spitzmäuschen (Aspidapion radiolus – ca. 2,2‑3,0 mm lang ohne Rüssel),
- der Kräftige Stockrosen-Spitzmausrüssler (Aspidapion validum – ca. 3,2‑4,0 mm lang ohne Rüssel) und
- der Krummrüsselige Stockrosen-Spitzmausrüssler (Alocentron curvirostre – ca. 2,9‑3,4 mm lang ohne Rüssel).
Sofern man diese vier auf den Pflanzen überhaupt entdeckt, erkennt man nur schwarze Käfer mit schwarzen Beinen und Rüsselchen, deren Flügeldecken in der Sonne metallisch glänzen (bläulich/

Rhopalapion longirostre – Paarung

Larvendomizil in Alcea-rugosa-Samen
Das Langrüsselige Stockrosen-Spitzmäuschen (Rhopalapion longirostre – ca. 2,2‑3,5 mm lang ohne Rüssel) und das Zweifarbige Malven-Spitzmäuschen (Malvapion malvae – ca. 1,8‑2,4 mm lang ohne Rüssel) sind dagegen mit bloßem Auge zu identifizieren: Das Langrüsselige ist so dicht grau behaart, dass der ganze Kerl grau erscheint, das Zweifarbige Malven-Spitzmäuschen schimmert matt kupferfarben und graubraun. Beide Arten staksen auf rötlichgelben bzw. rotbraunen Beinen durchs Rüsselkäfer-Leben. Die Larven dieser beiden Spitzmausrüssler-Arten verpuppen sich in den Samen ihrer Wirtspflanzen und halten damit deren Selbstaussaat in Schach. Alles hat eben zwei Seiten!

Malvapion malvae
Spitzmausrüssler (wie auch die Malven-Erdflöhe) lieben es, wenn ihre Wirtspflanzen trocken stehen. Allein durch regelmäßiges Gießen schon ab dem Frühjahr wird es also in niederschlagsarmen Jahren ungemütlicher für sie. Doch ein Allheilmittel ist Gießen natürlich nicht. Falls die Tierchen massenhaft auftreten, ist Geburtenkontrolle die unschädlichste Methode (außer natürlich für die Larven), ihre weitere Ausbreitung einzudämmen: abgefallene Blätter werden aufgesammelt und vernichtet, die Stängel im Spätsommer abgeschnitten und in der Biotonne entsorgt. Und natürlich werden auch die Samenstände frühzeitig – vorzugsweise noch grün – entfernt und in die Biotonne oder den Restmüll geworfen (auf den Kompost dürfen Stängel, Blätter und Samenstände in diesem Fall nicht).
Ulmenblasenlaus (Tetraneura ulmi)
Was Sie bei massenhaftem Auftreten gegen diese Läuse tun können (aber nicht müssen)
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
Tetraneura ulmii, so der wissenschaftliche Name der Ulmenblasenlaus, tritt an Ulmen recht häufig auf und hat uns im ersten Jahr ihres Vorkommens an unserer Ulmus glabra 'Camperdownii' vor Rätsel gestellt. Inzwischen sind wir schlauer:

Aus Eiern, die die Weibchen dieser Blasenlaus-Art im Herbst in den Ritzen der Rinde von Ulmen ablegen, schlüpfen im Frühjahr junge, flügellose, gelbgrüne Läuse. Diese Jungtiere stechen die frisch austreibenden Ulmenblätter auf der Unterseite an, was auf der Oberseite der malträtierten Blätter Blattgallen hervorruft. In diesen Gallen halten sich die Läuse auf und aus den blassen, flügellosen Jungspunden werden schwarze Läuse mit Flügeln. Die geflügelten Tiere begeben sich nach wenigen Wochen in die "Sommerfrische" (die Blattgallen gehen von selbst auf) und tun sich an den Wurzeln von Süßgräsern (Pflanzenfamilie der Poaceae) gütlich; während dieser Zeit vermehren sie sich ungeschlechtlich. Im Herbst kehren die Blasenläuse zurück zu Ulmen, dort erfolgt eine geschlechtliche Vermehrung (es gibt dann also Männchen und Weibchen) verbunden mit der Eiablage in der Ulmenrinde, und das Spiel, der Lebenszyklus, beginnt von Neuem.
 Mit ihrem Treiben richtet diese Lausart keine ernsthaften Schäden an, sofern die Ulme(n) wie auch die Gräser im Übrigen gesund sind. Sollte man trotzdem etwas gegen sie tun? Wenn der Anblick sehr stört und nicht der ganze Baum befallen ist, können die Blätter abgezwickt und vernichtet werden, damit zumindest die Vermehrung und weitere Verbreitung der Läuse etwas eingedämmt werden. Ansonsten – einfach damit leben. Schließlich braucht man ja auch Vogelfutter und Läuse stehen da hoch im Kurs, so als Snack zwischendrin. Und wo Läuse sind, sind außerdem zum Glück meist Fraßfeinde wie Marienkäfer
Mit ihrem Treiben richtet diese Lausart keine ernsthaften Schäden an, sofern die Ulme(n) wie auch die Gräser im Übrigen gesund sind. Sollte man trotzdem etwas gegen sie tun? Wenn der Anblick sehr stört und nicht der ganze Baum befallen ist, können die Blätter abgezwickt und vernichtet werden, damit zumindest die Vermehrung und weitere Verbreitung der Läuse etwas eingedämmt werden. Ansonsten – einfach damit leben. Schließlich braucht man ja auch Vogelfutter und Läuse stehen da hoch im Kurs, so als Snack zwischendrin. Und wo Läuse sind, sind außerdem zum Glück meist Fraßfeinde wie Marienkäfer
Blöd ist nur, dass die Antagonisten in diesem Fall so schlecht an die Läuse rankommen – in den Blattgallen nicht und an den Gräserwurzeln auch nicht. An kleineren Bäumen ist deshalb auch eine Austriebsspritzung mit Promanal® im Frühling eine Option. Der Hauptbestandteil dieses Pflanzenschutzmittels ist Paraffinöl und von daher ungefährlich für Mensch, Hund und Katz. Die Fraßfeinde allerdings trifft's bei so einer Spritzung ebenfalls …
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
 Sie schienen die Übernahme unserer Gärten, Terrassen und Balkone entschlossen anzugehen – flinke kleine Krabbeltiere, die kräftig zubeißen und fürchterlich nerven können, wenn sie zu Dutzenden über Kuchenteller huschen oder – noch schlimmer – vom Rasenmäher aufgeschreckt Zuflucht oder Rache in unseren Hosenbeinen suchen.
Sie schienen die Übernahme unserer Gärten, Terrassen und Balkone entschlossen anzugehen – flinke kleine Krabbeltiere, die kräftig zubeißen und fürchterlich nerven können, wenn sie zu Dutzenden über Kuchenteller huschen oder – noch schlimmer – vom Rasenmäher aufgeschreckt Zuflucht oder Rache in unseren Hosenbeinen suchen.
Seit ein paar Jahren nimmt die Ameisenpopulation in meinem Garten jedoch deutlich ab. Natürlich sind nach wie vor gelbe, rote, braune und schwarze Ameisen geschäftig unterwegs, falls sich auf irgendeiner Pflanze Blattläuse niederlassen. Doch die Nester im Rasen (bei uns eher bloß Gras) und in den Beeten werden weniger und unterhöhlte Pflanzen finde ich immer seltener. Darüber, sie vertreiben zu müssen, brauche ich mir jedenfalls keine Gedanken mehr zu machen. Gut so, denn tatsächlich kenne ich kein Mittel, das wirklich gegen Ameisen hilft. Weder die mir bekannten überlieferten Hausmittel noch handelsübliche Industrieprodukte haben je gegen die Ameisen in meinem Garten etwas ausrichten können.

Ameisenhaufen im Gras
Bleibt zu hoffen, dass die Allesfresser Ameisen (sie entsorgen also auch Aas) ihre Aufgaben als "Gesundheitspolizei" im Garten trotz verringerter "Mannstärke" weiterhin in vollem Umfang wahrnehmen können. Und dass doch noch so viele Völker verblieben sind, dass der Grünspecht satt wird, der das Grundstück systematisch nach den Krabblern absucht und so lange im Boden stochert, bis ein Ameisennest leer geräumt ist.

Grünspecht-Dame

Grünspecht-Dame

"Arbeitsplatz" des Grünspechts
Die Löcher, die er dabei (vorzugsweise im Gras) hinterlässt, ähneln dem Eingang zu einem Wühlmausbau, schließlich muss ja der ganze Specht-Kopf in das Loch passen, nicht nur der Schnabel, um tief genug nach den kostbaren Leckerbissen schürfen zu können. Vorsicht also mit vorschnellen Anschuldigungen: Nicht immer verursachen Mäuse die Krater im Rasen!
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten

Wespen-Männchen (Drohne) auf Efeu-Blüten
"Der tut nix." Wirklich geholfen ist Menschen, die sich vor Hunden fürchten, mit diesem Satz nicht. Ähnlich geht es vielen mit den Deutschen Wespen (Vespula germanica) und den Gemeinen Wespen (Vespula vulgaris): Der Kopf sagt "Bleib ganz ruhig", doch die Hände verteidigen gleichzeitig aufgeregt den Eisbecher, den Zwetschgenkuchen oder den Grillteller. Da nichts zu tun, ist eben schwer, denn wer mag schon Mitesser?
Es ist aber tatsächlich so, dass Wespen umso schneller verschwinden, je mehr Ruhe sie haben. Und ein Schälchen mit Apfelsaft oder Cola, gern auch ein Stückchen Fleisch oder Wurst, etwas abseits auf dem Tisch oder dem Boden entspannt die Situation ebenfalls ungemein. Diesbezüglich haben die überlieferten Tipps und Tricks durchaus ihren Sinn. Also: Bleiben Sie ruhig, decken Sie Ihre Speisen und Getränke im Freien möglichst ab und achten Sie auf jeden Bissen, den Sie auf der Gabel oder dem Löffel haben sowie auf jeden Schluck aus der Tasse oder dem Glas, damit nicht versehentlich eine Wespe in Mundnähe gelangt.

Königin der Deutschen Wespe – Nest in altem Mäusekessel
Früher (es gab schon Farbfernsehen) sind mir in Nebengebäuden (Schuppen und Ähnliches) Wespennester oft als "Burg" (mit schützender Umhüllung) eines großen Volkes begegnet. Das waren Nester der allgegenwärtigen und furchtbar lästigen, weil aggressiven Vespula vulgaris (Gemeine Wespe) und Vespula germanica (Deutsche Wespe). Solche Nester entdecke ich inzwischen keine mehr, die neueren Schuppen im Garten scheinen ihnen nicht mehr zu taugen. So dürfte es ihnen nahezu überall ergehen, denn wenn ich an früher denke, ist die Wespenplage heute genau betrachtet gar keine Plage mehr, sondern nur noch der Besuch einzelner Individuen. Aber in den Boden sehe ich noch Wespen krabbeln, sie scheinen bei mir also aufs Nisten in alten Mäusekesseln auszuweichen. Die gibt's hier in Hülle und Fülle.

Wespen auf Eryngium giganteum
Kurz zur Lebensweise der Sozialen Faltenwespen: Unter anderem die Deutsche und die Gemeine Wespe bilden individuenreiche Völker (Staaten), die eine begattete Jungkönigin nach dem Überwintern im Frühjahr (April/
Wespen haben nur einen kurzen Rüssel. Wenn sie Nektar tanken wollen, müssen sie sich deshalb Blüten mit "obenliegender Nektarausgabe" aussuchen um ranzukommen. Eryngium (Edeldistel, Mannstreu) erfreut sich da auch bei der Deutschen und der Gemeinen Wespe besonderer Beliebtheit. Wer sie nicht noch mehr anlocken will, sollte daher im Garten – zumindest in der Nähe der Terrasse – auf diese Edeldisteln verzichten. Sicher ist sicher.
Alle anderen Wespenarten sind übrigens harmlos und werden weder lästig noch aggressiv. Ihr Glück, denn wer niemandem auf die Nerven geht, läuft auch nicht Gefahr, erschlagen zu werden.
Vespula germanica und vulgaris – Verwechslung mit anderen Wespen-Arten
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
Es ist nicht ganz einfach, die Deutsche sowie die Gemeine Wespe (also die, die uns den Nerv töten) von anderen, ähnlich gefärbten (schwarz-gelb) Insekten zu unterscheiden. Das gelingt meist erst nach einer Weile durch Erfahrung, wenn sich eine gewisse Routine im Beobachten von Insekten einstellt.

Hornissen-Weibchen (Vespa crabo) auf Efeu-Blüten
Da wäre zum Beispiel die Hornisse (Vespa crabo), die den Wespen (gemeint sind hier mit diesem nicht näher bestimmten Begriff immer die Deutsche und die Gemeine Wespe) zum Verwechseln ähnlich sieht, wäre da nicht ihre schiere Größe als Unterscheidungsmerkmal; 15‑26 mm misst so ein Hornissen-Weibchen (Arbeiterin). Zum Vergleich: Eine Arbeiterin der Wespen misst zwischen 10 und 16 mm (Gemeine Wespen sind etwas kleiner als Deutsche). Verwechseln könnte man Hornissen schon wegen der Größe also nur mit einer Königin (16‑21 mm) oder einem Männchen (Drohne, 13‑17 mm) der Wespen, doch Erstere verlässt das Nest nicht mehr, sowie es Arbeiterinnen gibt (Frühsommer), und die Drohnen fliegen nur im (Spät-)
Weiter geht's mit den vielen anderen Wespen wie Lehmwespen, Grabwespen, Knotenwespen, Pillenwespen, Feldwespen und anderen mehr mit schwarz-gelber Zeichnung. Da hilft nur Übung, um sie zuverlässig von den lästigen Wespen zu unterscheiden. Ganz "grob" gesagt, merkt man am Verhalten, mit wem man es zu tun hat, denn diese anderen Arten sind bedeutend friedliebender und machen eher einen Bogen um uns Menschen. Sitzen sie auf Blüten, gelingt es vielleicht, den Körperbau und die Zeichnung eingehender zu studieren, was ebenfalls mit ein bisschen Übung zum ungefähren Zuordnen zur einen oder anderen Gattung führen kann.

Bienenjagende Knotenwespe (Cercis rybyensis)

Lehmwespe (Ancistrocereus nigricornis)

Grabwespe (Ectemnius spec.)

Knotenwespe (Cerceris spec.)
Die Feldwespe (Polistes dominula, eine der Sozialen Faltenwespen) ist besonders leicht zu erkennen und bestimmen, denn ihre Fühler sind ab dem dritten Fühlerglied orange und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal unter den einheimischen Wespen-Arten. Ihre Nester bestehen oftmals nur aus wenigen Waben, die im Gegensatz zu denen von Vespula germanica und vulgaris ohne Hülle sind.

Feldwespe (Polistes dominula)

Eine Feldwespe (Polistes dominula) schlüpft
Sehr leicht macht es uns auch der Bienenwolf (Philantus triangulum, eine Grabwespe), zumindest die Männchen mit ihrer auffälligen Gesichtszeichnung: sie tragen zwischen den Augen eine gelbe/

Bienenwolf-Männchen (Philanthus triangulum)

Bienenwolf-Männchen (Philanthus triangulum)
Vespula germanica und vulgaris – Verwechslung mit Schwebfliegen und Wildbienen
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
BlattläuseSchnecken
Weiße Fliege
Wühlmäuse
Engerlinge
Amsel und Spatz
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
AfterraupenBrauner Mönch, Königskerzen-Mönch
Johannisbeer-Blasenlaus
Kohlweißlinge
Lilienhähnchen
Malven-Erdfloh
Minze-Blattkäfer
Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
Spitzmausrüssler
Ulmenblasenlaus
Eher tierische Nervlinge als Schädlinge
AmeisenWespen und Verwechslungsarten
Es gibt eine Menge Schwebfliegen mit gelb-schwarzer Zeichnung. Die praktische, auf Wespen (gemeint sind Deutsche Wespe – Vespula germanica – sowie die Gemeine Wespe – Vespula vulgaris) deutende Warnfarbe bietet ihnen offenbar einen gewissen Schutz vor Feinden. Schwebfliegen lassen sich anhand ihres Körperbaus (meist eher pummelig denn schlank), der Kopfform, den kurzen (allen Fliegen eigenen) Fühlern bzw. Antennen sowie dem Flugverhalten einordnen. Sie "schweben" in der Luft über einer Blüte, bevor sie sich niederlassen, das hat ihnen ihren deutschen Namen beschert. Gelb-schwarz gezeichnet und bei uns im Garten häufig sind die folgenden Arten:

Totenkopfschwebfliege (Myathropa florea – 10‑14 mm)

Verralls Wespenschwebfliege (Chrysotoxum verrallii – 10‑13 mm)

Große Schwebfliege (Syrphus ribesii – 9‑13 mm)

Frühe Großstirnschwebfliege (Scaeva selenitica – 12‑16 mm)

Mondfleck-Feldschwebfliege (Eupeodes luniger – 9‑12 mm)

Gemeine Wespenschwebfliege (Chrysotoxum cautum – 12‑15 mm)
Auf den ersten Blick könnten Wespen zudem mit Wildbienen-Arten verwechselt werden, doch das passiert Ihnen nicht lange. Wenn Sie sich erst mal ein wenig an der Insektenbeobachtung versucht haben, merken Sie gleich, wer eine Wespe ist und wer eine (Wild-)

Felsspalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum, Weibchen – 9‑13 mm)

Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum, Weibchen) – 14‑18 mm)
Schwieriger sind größere Wespenbienen-Arten (Gattung Nomada) einzuordnen, wie der deutsche Name bereits vermuten lässt (zum Beispiel Nomada goodeniana mit 10‑13 mm, Nomada fulvicornis mit 10‑13 mm, Nomada marshamella mit 10‑13 mm, Nomada sexfasciata 11‑14 mm). Doch auch das gelingt mit etwas Training, denn ihnen fehlt die klassische Wespentaille. Die Körperform insgesamt sowie die Zeichnungen sind ganz anders, die Fühler und/

Feld-Wespenbiene (Nomada goodeniana, Weibchen)

Wiesen-Wespenbiene (Nomada marshamella, Weibchen)
Zum Seitenanfang
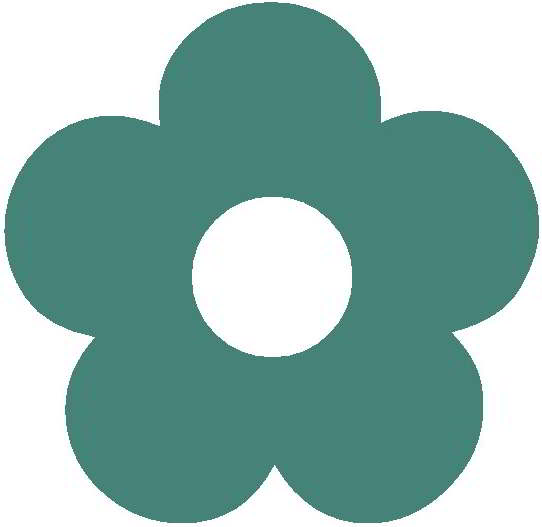

Tierischer Ärger im Garten
Besonders häufige tierische Pflanzenschädlinge
Spezialisierte tierische Pflanzenschädlinge
- Afterraupen
- Brauner Mönch, Königskerzen-Mönch
- Johannisbeer-Blasenlaus
- Kohlweißlinge
- Lilienhähnchen
- Malven-Erdfloh
- Minze-Blattkäfer
- Pfaffenhütchen-Gespinstmotten
- Spitzmausrüssler
- Ulmenblasenlaus
