Asphodeline – Junkerlilie
(Pflanzenfamilie: Xanthorrhoeaceae – Grasbaumgewächse
früher: Asphodelaceae – Affodillgewächse)

Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill) – Blüten
Anfang des neuen Jahrtausends war ich noch etwas skeptisch, was die Winterhärte der Junkerlilien in Mitteleuropa anbelangt, und habe zu Winterschutz in den meisten Gegenden Deutschlands geraten. Aber Anfang dieses Jahrtausends gab es ja auch (Experten-)
Bislang waren Asphodeline lutea und Asphodeline liburnica – diese beiden Arten sind für die Gartenkultur relevant – jedenfalls winterhart bei mir in Mittelfranken in der leichten Talsohle – ohne Winterschutz! Warum also nicht auch anderswo in Deutschland und nicht nur im Weinbauklima?

Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie) vor Lavandula angustifolia (Echter Lavendel)
Am problematischsten sollte für Junkerlilien-Arten hier bei mir der Lehmboden (sandiger Lehm, mehr lehmig als sandig) sein, der speziell im Winter stark dazu tendiert zu vernässen. Doch weit gefehlt: Dieser Boden, bei dem fast immer latent Staunässegefahr gegeben ist – selbst in feuchten Sommern –, hat den dicken, fleischigen Wurzeln (Rhizom) von Asphodeline liburnica und lutea bislang nicht im Geringsten geschadet (und Asphodeline lutea kultiviere ich seit über 20 Jahren). Bei der Standortwahl war ich dabei nicht zimperlich, es ist deshalb nicht so, dass die beiden immer einen Platz in gut drainierter Erde bekommen hätten, wie das beispielsweise in einem Steingarten der Fall ist und, wie es diese Pflanzen an den Naturstandorten im Mittelmeerraum vorfinden (Macchien, Felsflächen etc.).

Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie) im Frühling
Traun Sie sich daher ruhig ran an die Junkerlilien, sie kommen mit schlechteren Voraussetzungen zurecht, als man ihnen nachsagt und zutraut. Winterschutz ist dabei höchstens in sehr rauen Regionen nötig; bei mir leidet das (im Winter grüne) Laub noch nicht einmal unter Kahlfrösten (Frost ohne schützende Schneedecke); es sind im Frühling keine Verbrennungen (braune Stellen) an den langen, schmalen Blättern festzustellen (wenn das Wasser in den Leitungsbahnen gefroren ist und daher für die Photosynthese bei Sonnenschein nicht zur Verfügung steht, "verbrennen" die Blätter); schlimmstenfalls sind mal ein paar Blattspitzen vertrocknet. Wer ganz sicher gehen will oder den Garten "in einem Kälteloch" hat, kann ein paar Fichten- oder Tannenzweige locker zum Beschatten über die Horste legen oder rundherum in die Erde stecken. Eine gelegentliche Kontrolle, was der Wind damit gemacht hat, schadet nicht.

Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie) im Frühling
Asphodeline liburnica und lutea sind die beiden Junkerlilien-Arten, die in den Gärtnereien am häufigsten angeboten werden, wobei die Liburnische Junkerlilie erst seit ein paar Jahren in den Sortimenten eine Rolle spielt. Bleibt zu hoffen, dass ihre Verbreitung in den Gärten zunimmt, denn beide sind es wert, kultiviert zu werden. Vermehren lassen sich diese zwei Arten – außer durch (Selbst-)
Asphodeline liburnica – Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie
Asphodeline liburnica Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie
Asphodeline lutea Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill

Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie) – Blüten
Vor dem Nachmittag ist mit der Liburnischen Junkerlilie nicht zu rechnen, denn erst dann – zwischen 15:30 und 16:00 (Mitteleuropäische Sommerzeit) – öffnen sich ihre zitronengelben Blüten. Asphodeline liburnica kommt ehr ungestüm daher und macht immer einen etwas zerzausten Eindruck: Die dünnen Blütentriebe werden vom Wind bald in diese, bald in jene Richtung geschoben. Irgendwann im Lauf der Blüte zeigen sie dann meist die Hauptwindrichtung an und stehen leicht schräg. Gegebenenfalls sollte daher mit diesem Pflanzen ausreichend Abstand zu Wegen eingeplant werden, damit man sich beim Gartenbesuch nach Regen keine nassen (Hosen-)

Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie) – Samenstände
Während oben die Samen reifen und die Blätter an den Blütentrieben (etwa bis zur Hälfte dicht beblättert) nach und nach absterben, treibt die Liburnische Junkerlilie um die Blütentriebe herum neu aus. Sie macht also keine Sommerpause, wie Asphodeline lutea das tut. Nach der Blüte ist es deshalb kein Schaden, die Blütentriebe bodennah abzuschneiden (sie neigen sich mit den schweren Fruchtständen noch mehr), schon allein um die reichliche Selbstaussaat zu unterbinden. Asphodeline liburnica blüht erst nach Asphodeline lutea, das ist wie bei den Graslilien: Wenn die Astlose oder Traubige Graslilie (Anthericum liliago) fertig ist, fängt die Ästige oder Rispige Graslilie (Anthericum ramosum) an.

Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie) – sommerlicher Neuaustrieb
In naturnahen Gärten oder auf Flächen, die erst noch durch Selbstaussaat besiedelt oder komplettiert werden sollen, kann der Rückschnitt nach der Blüte natürlich auch unterbleiben; dann werden die Überreste der Blütentriebe eben erst im Frühling entfernt. Die (immergrünen) blau- bis graugrünen Blatthorste überstehen den Winter bei mir nahezu ohne Schäden (Verbrennungen) – trotz fehlender Schneedecke und ohne Winterschutz.

3-jährige Asphodeline liburnica (Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie)
Im Laufe der Jahre bilden diese Junkerlilien stattliche Horste, ihr Breitenwachstum geht jedoch eher langsam vor sich, weil sich Asphodeline liburnica mit ihrem Rhizom (ein Rhizom ist ein mehr oder weniger stark verdickter, meist unterirdisch wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) nur gemächlich verbreitert. Trockene Standorte in der vollen Sonne stellen dabei kein Problem dar – im Gegenteil: sie sind Voraussetzung (leicht beschattete Plätze werden toleriert). Sollte es ihr tatsächlich mal zu trocken werden, dann sterben eben die alten Laubblätter etwas früher ab, doch was soll's?
Kaum jemand weiß heute noch, wo Liburnien ist, besser gesagt war. Botanische Pflanzennamen mit "liburnica" als beschreibenden Teil des Namens (der erste Teil des wissenschaftlichen Namens – in diesem Fall Asphodeline – ist der Name der Gattung) transportieren also eine längst vergessene territoriale Einteilung an der Küste Kroatiens in die heutige Zeit. Denn dort ist die Liburnische Junkerlilie beheimatet, heute noch, in Kroatien, im Hinterland der Küste und auf den Inseln südlich von Istrien.
Asphodeline liburnica – Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie
| Wuchshöhe: | 100-150 cm |
| Blütenfarbe: | gelb |
| Blütezeit: | Juni, Juli |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | Staunässe vermeiden |
Asphodeline lutea – Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill
Asphodeline liburnica Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie
Asphodeline lutea Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill
 Von der Goldgelben Junkerlilie (oft auch Gelber Affodill genannt) hat man ohne zeitraubende Pflege nahezu rund ums Jahr etwas, denn ihre Blattrosetten sind auch im Winter präsent (herbst-frühsommergrün). Neben und zwischen Steinen (Standort Steingarten etwa) macht sich das sehr apart, wenn ringsum alles kahl ist und nur die blaugrünen/
Von der Goldgelben Junkerlilie (oft auch Gelber Affodill genannt) hat man ohne zeitraubende Pflege nahezu rund ums Jahr etwas, denn ihre Blattrosetten sind auch im Winter präsent (herbst-frühsommergrün). Neben und zwischen Steinen (Standort Steingarten etwa) macht sich das sehr apart, wenn ringsum alles kahl ist und nur die blaugrünen/

Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie) – Samenstand
Ab Mai lenken die sonnengelben Blütenstände vom Blatt ab (obwohl die Stängel bis zum Blütenansatz reich damit besetzt sind), nach der Blüte die Samenstände mit den großen, kugeligen Früchten, die dicht an dicht am Stiel stehen. Sie abzuschneiden, bringt niemand so schnell übers Herz, und das hat man dann davon: Die Samen der Junkerlilie keimen – vermutlich unter anderem dem Klimawandel geschuldet – auch in unseren Breiten recht gut im Garten. Allerdings stehen die jungen Pflanzen bei Schnecken auf dem Speiseplan (wohingegen sie ältere Exemplare nicht besonders interessieren), was die Samenausbreitung des Gelben Affodills im Garten überschaubar macht. Überzählinge Sämlinge lassen sich mit einem kleinen Schäufelchen leicht und "rückstandslos" entfernen, wohlgemerkt: Sämlinge, nicht die ausgewachsenen Exemplare.

Asphodeline lutea (Junkerlilie) – Sämling
Asphodeline lutea breitet sich mit kurzen unterirdischen Ausläufern aus, der Standort muss allerdings schon optimal für sie sein, um damit unerwünscht große Bestände zu bilden. Optimal heißt bei ihr durchlässiger Boden, wie sie ihn an ihren Naturstandorten vorfindet. (Diese Junkerlilie stammt aus dem südlichen und östlichen Mittelmeerraum und lebt dort sehr bescheiden in Felsgebieten und den Macchien.) Meine Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Goldgelbe Junkerlilie selbst mit schweren Lehmböden – wie bei mir im Garten – nicht nur zurechtkommt, sondern darin gut wächst und jedes Jahr opulent blüht. Lediglich ihr Breitenwachstum wird eben etwas verlangsamt und beschränkt.

Knospige Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill)
Was sie nicht recht verträgt, ist Staunässe (vor allem im Winter), die erhöht das Risiko, dass ihre dickfleischigen Wurzeln faulen, immens. Ansonsten ist Asphodeline lutea im deutschen Klima (stark verallgemeinert ausgedrückt) absolut winterhart, selbst mehrere aufeinanderfolgende Nächte mit Temperaturen an die ‑20 °C und ohne Schneedecke richten bei ihr keinen Schaden an.
Asphodeline lutea ist das, was man (ab der Blüte) als eine feste Größe im Garten bezeichnen kann, und zwar im wörtlichen Sinn: Die stabilen Blütentriebe wachsen straff aufrecht und keine Windböe und auch keine Wetterkapriolen schaffen es, sie zum Knien oder wenigstens zu einem schiefen Wuchs zu bringen. Das gelingt nicht einmal, wenn schon die schweren, runden Früchte dicht an dicht an den Stängeln stehen.

Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea, Weibchen) auf Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie)
An den kerzenförmigen Blütenständen öffnen sich immer nur einige der großen Blüten an den verschiedensten Stellen (das ist vergleichbar mit den Blütenständen vieler Königskerzen – Verbascum). Die größten Fans dieser Blüten sind in meinem Garten zweifellos die Blauschwarzen Holzbienen (Xylocopa violacea), die zur Blütezeit der Asphodeline lutea jeden Morgen geradezu darauf warten, dass die Blüten aufmachen, oder sogar schon vorher in die noch geschlossenen Blüten rüsseln. Ich gehe davon aus, dass das Interesse der Holzbienen ausschließlich dem angebotenen Nektar gilt (zur Eigenversorgung) und kein Pollen zur Brutversorgung gesammelt und eingetragen wird.

Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie) mit Linum perenne (Stauden-Lein)
Suchen Sie für die Asphodeline lutea am besten einen vollsonnigen Standort (leicht beschattet ist ebenfalls möglich) und denken Sie bei der Auswahl daran, dass sie äußerst trockenheitsverträglich ist. Sie ist damit die ideale Staude für Plätze, die in vielen Gärten als Problemstandorte gelten. Bei uns im Garten steht die Junkerlilie unter anderem neben Helianthemum apenninum (Apenninen-Sonnenröschen), Linum perenne (Ausdauernder Lein, Stauden-Lein) und Veronica gentianoides (Enzian-Ehrenpreis). Schön kann ich mir auch Verbascum phoeniceum 'Violetta' (Purpur-Königskerze) und Campanula sarmatica (Sarmatische Glockenblume) oder garganica (Stern-Polster-Glockenblume) dazu vorstellen.
Nach der Blüte zieht der Gelbe Affodill ein und macht in der heißesten Zeit des Jahres Sommerpause. Wenn die größte Hitze vorbei ist – im Spätsommer – treibt er neu aus; dieses Laub überwintert dann "grün" (in diesem Fall blaugrün oder graugrün). Asphodeline lutea ist demnach "wintergrün", noch korrekter ist die Bezeichnung "herbst-frühsommergrün", weil ihre Vegetationsphase im Spätsommer beginnt und bis zum Frühsommer andauert; sie gipfelt in der Blüte.

Asphodeline lutea (Goldgelbe Junkerlilie) im Winter
Der Begriff "wintergrün" wird inzwischen leider geradezu inflationär für alle Pflanzen verwendet, die im Winter ihr Laub behalten oder neu bilden. Solche Verallgemeinerungen sind nicht korrekt, denn es gibt viele verschiedene Laubrhythmen, die im Winter grünes Laub bescheren (nach Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland Band 5, Springer Spektrum, S. 33, 34), darunter immergrün (in verschiedenen Ausprägungen), frühjahrsgrün, herbst-frühjahrsgrün und eben herbst-frühsommergrün. DAS Wintergrün schlechthin gibt es nicht.
Asphodeline lutea – Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill
| Wuchshöhe: | 50-125 cm |
| Blütenfarbe: | gelb |
| Blütezeit: | Mai, Juni |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Schnittpflanze |
| Hinweis: | Staunässe vermeiden |
Zum Seitenanfang
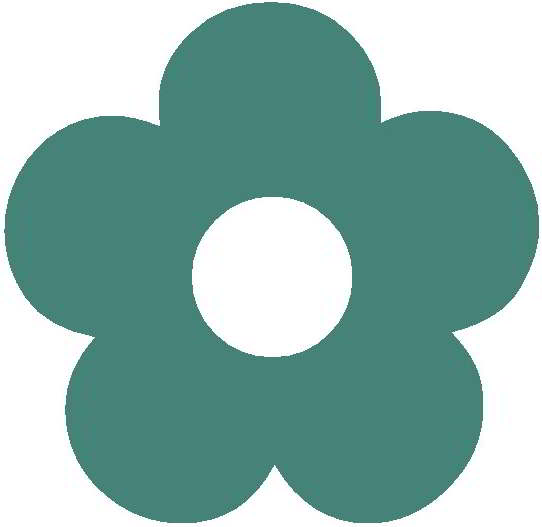
Weitere Staudengattungen
Achillea (Schafgarbe)
Acinos (Steinquendel)
Aconitum (Eisenhut)
Aconogonon (Bergknöterich)
Agastache (Duftnessel)
Ajuga (Günsel)
Alcea (Stockrose)
Alchemilla (Frauenmantel)
Althaea (Eibisch)
Alyssum (Steinkraut)
Amsonia (Blausternbusch)
Anaphalis (Perlkörbchen)
Androsace (Mannsschild)
Anemone (Anemone)
Antennaria (Katzenpfötchen)
Anthericum (Graslilie)
Aquilegia (Akelei)
Arabis (Gänsekresse)
Aralia (Aralie)
Arenaria (Sandkraut)
Armeria (Grasnelke)
Artemisia (Silberraute)
Aruncus (Geißbart)
Asphodeline (Junkerlilie)
Aster (Aster)
Astrantia (Sterndolde)
Aurinia (Steinkresse)
Baptisia (Indigolupine)
Bergenia (Bergenie)
Brunnera (Kaukasusvergissmeinnicht)
Buglossoides (Steinsame)
Calamintha (Bergminze)
Campanula (Glockenblume)
Centaurea (Flockenblume)
Cephalaria (Schuppenkopf)
Chamaemelum (Römische Kamille)
Chrysanthemum (Chrysantheme)
Clematis (Waldrebe)
Clinopodium (Bergminze)
Coreopsis (Mädchenauge)
Cymbalaria (Zimbelkraut)
Datisca (Scheinhanf)
Delphinium (Rittersporn)
Dianthus (Nelke)
Dictamnus (Diptam)
Digitalis (Fingerhut)
Dracocephalum (Drachenkopf)
Dryas (Silberwurz)
Echinacea (Scheinsonnenhut)
Echinops (Kugeldistel)
Echium (Natternkopf)
Epilobium (Weidenröschen)
Eryngium (Edeldistel, Mannstreu)
Euphorbia (Wolfsmilch)
Eurybia (Aster)
Filipendula (Mädesüß)
Gaillardia (Kokardenblume)
Galatella (Aster)
Gaura (Prachtkerze)
Gentiana (Enzian)
Geranium (Storchschnabel)
Geum (Nelkenwurz)
Gillenia (Dreiblattspiere)
Gypsophila (Schleierkraut)
Helenium (Sonnenbraut)
Helianthemum (Sonnenröschen)
Helianthus (Sonnenblume)
Heliopsis (Sonnenauge)
Helleborus (Christrose, Nieswurz)
Hemerocallis (Taglilie)
Herniaria (Bruchkraut)
Heuchera (Purpurglöckchen)
Hosta (Funkie)
Hypericum (Johanniskraut)
Hyssopus (Ysop)
Iberis (Schleifenblume)
Jasione (Sandglöckchen)
Kalimeris (Schönaster)
Knautia (Witwenblume)
Kniphofia (Fackellilie)
Lamium (Goldnessel)
Lavandula (Lavendel)
Leonurus (Herzgespann)
Leucanthemum (Garten-Margerite)
Liatris (Prachtscharte)
Ligularia (Goldkolben)
Limonium (Strandflieder, Meerlavendel)
Linaria (Leinkraut)
Linum (Lein)
Lithospermum (Steinsame)
Lupinus (Lupine)
Lychnis (Lichtnelke)
Lysimachia (Felberich)
Lythrum (Weiderich)
Malva (Malve)
Melissa (Melisse)
Mentha (Minze)
Monarda (Indianernessel)
Nepeta (Katzenminze)
Oenothera (Nachtkerze)
Oligoneuron (Aster)
Origanum (Dost, Oregano, Majoran)
Paeonia (Pfingstrose)
Papaver (Mohn)
Penstemon (Bartfaden)
Petrorhagia (Felsennelke)
Phlomis (Brandkraut)
Phlox (Flammenblume)
Platycodon (Ballonblume)
Polemonium (Jakobsleiter)
Polygonatum (Salomonssiegel)
Potentilla (Fingerkraut)
Primula (Aurikel, Schlüsselblume, Primel)
Prunella (Braunelle)
Pseudofumaria (Lerchensporn)
Pulmonaria (Lungenkraut)
Pulsatilla (Kuh-/Küchenschelle)
Rudbeckia (Sonnenhut)
Ruta (Raute)
Salvia (Salbei)
Sanguisorba (Wiesenknopf)
Saponaria (Seifenkraut)
Satureja (Bohnenkraut)
Saxifraga (Steinbrech)
Scabiosa (Skabiose)
Sedum (Fetthenne)
Sempervivum (Hauswurz)
Sideritis (Bergtee)
Silene (Leimkraut)
Solidago (Goldrute)
Stachys (Ziest)
Symphyotrichum (Aster)
Symphytum (Beinwell)
Tanacetum (Bunte Margerite)
Teucrium (Gamander)
Thalictrum (Wiesenraute)
Thymus (Thymian)
Tiarella (Schaumblüte)
Tradescantia (Dreimasterblume)
Trifolium (Klee)
Trollius (Trollblume)
Verbascum (Königskerze)
Verbena (Verbene)
Vernonia (Scheinaster)
Veronica (Ehrenpreis)
Veronicastrum (Arzneiehrenpreis)
Vinca (Immergrün)
Viola (Veilchen)
Waldsteinia (Waldsteinie)
Yucca (Palmlilie)
Asphodeline liburnica Liburnische Junkerlilie, Balkan-Junkerlilie
Asphodeline lutea Goldgelbe Junkerlilie, Gelber Affodill

 größeres Bild
größeres Bild