Eurybia – Großblattaster
(Pflanzenfamilie: Asteraceae – Korbblütler)

Sämling von Eurybia divaricata (Weiße Waldaster)
In die Gattung Eurybía (Betonung auf dem "i") wurden vor einiger Zeit mehrere Astern-Arten (Heimat: Nordamerika sowie nördliches Eurasien) aus der Gattung Aster ausgegliedert, die alle ein Rhizom und entweder eiförmige bis spatelförmige Blätter mit konischer oder V-förmiger Blattbasis (Eurybia sibirica etwa, die Arktische oder Sibirische Aster) haben oder große, herzförmige bis annähernd dreieckige Grundblätter, die eine Art Rosette bilden (Eurybia divaricata [Weiße Waldaster]) und Eurybia macrophylla [Herzblättrige Aster] zum Beispiel). Die Arten in der Gattung Eurybia haben während der Blüte eine gelbe Blütenscheibe (Körbchen); verblühte Blüten erkennt man an der purpurfarbenen Scheibe (purpurrot, purpurviolett, so in die Richtung).
Mit ihrem Rhizom (ein Rhizom ist ein mehr oder weniger stark verdickter, meist unterirdisch wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) breiten sich einige der durch die Bank staudigen, also winterharten, mehrjährigen Arten dieser Gattung aus (stärker oder schwächer). Das sollte für niemanden ein Grund sein, sie zu meiden: Eine Wurzelsperre aus stabiler Teichfolie oder sogar nur einem großen Plastikkübel mit Löchern im Boden, die/
Eurybia divaricata – Weiße Waldaster
alt: Aster divaricatus
Eurybia divaricata Weiße Waldaster
Eurybia macrophylla Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
Eurybia sibirica Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster

Eurybia divaricata (Weiße Waldaster) – Sämling
Aus den USA kam einst die Weiße Waldaster nach Europa, wo sie mittlerweile als eingebürgert gilt.
Eurybia divaricata (Aster divaricatus) verträgt unter den Astern am meisten Schatten und ist zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet. Sie sät sich wie Symphyotrichum oolentangiense (Aster azureus – Himmelblaue Aster) oder Symphyotrichum laeve (Aster laevis – Glatte oder Kahle Aster) gern aus (in der neuen Gattung Symphyotrichum sind die Herbstastern zusammengefasst). Mitunter keuzt sie sich zudem mit anderen Astern-Arten und passt mit diesen Eigenschaften gut in eine Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
. Wo eine Selbstaussaat der Weißen Waldaster unerwünscht ist, müssen verblühte Blütentriebe unbedingt vor der Samenreife abgeschnitten werden.
Meine Meinung: eine der schönsten hohen Spätsommerastern. Nicht nur wegen ihrer vielen filigranen weißen, leicht rosa überlaufenen Blüten, vor allem wegen ihrer außergewöhnlichen purpurfarbenen Stängel. Dass die Weiße Waldaster mit ihren großen, fast herzförmigen Grundblättern das Zeug zum Bodendecker hat, macht sie für viele Gartengestaltungen noch interessanter.

Eurybia divaricata (Weiße Waldaster) mit Stipa calamagrostis (Silberährengras)
Eurybia divaricata (Aster divaricatus) hat sich bei uns im Garten über die Jahre als relativ standfest erwiesen. Ein magerer, wenig gedüngter Standort ist für einen stabilen Wuchs der Weißen Waldaster empfehlenswert, und da Lehmboden – wie hier im Garten – von vornherein eher nährstoffreich ist, spricht das für ihre Standfestigkeit.
Hier noch ein paar Stauden und Gräser, mit denen sich als Begleiter dieser Aster stimmungsvolle Arrangements zaubern lassen: Vernonia arkansana (Arkansas-Scheinaster), Gaura lindheimeri (Prachtkerze), hohe Phlox-Arten (Phlox, Flammenblume) oder Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis) und als Ziergräser Panicum virgatum (Echte Rutenhirse, eventuell in Sorten) und Stipa calamagrostis (Alpen-Raugras, Silberährengras).
Hinweis: In vielen Beschreibungen ist die Rede davon, dass sich diese Aster (stark) ausbreitet (Ausläufer/
- Ich kultiviere gar keine Eurybia divaricata, sondern eine andere, äußerlich der Weißen Waldaster sehr ähnliche Art.
- Die Autoren/
Autorinnen irren sich (Fachliteratur und World Wide Web); das kann schon mal passieren, wenn derjenige/ diejenige mit einer Aussage falsch liegt, von dem/ der die meisten anderen ihr Wissen beziehen ("abschreiben“) – in der Literatur ebenso wie im Netz. - Es hängt mit dem Boden zusammen, ob und wie stark sich Eurybia divaricata ausbreitet. In diesem Fall hätten die Autoren recht und ich trotzdem Weiße Waldastern im Garten.
Eurybia divaricata – Weiße Waldaster
| Wuchshöhe: | 40-100 cm |
| Blütenfarbe: | weiß, oft rosa bis violett überhaucht |
| Blütezeit: | August, September |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch-mäßig trocken |
| Verwendung: | Schnittpflanze |
| Hinweis: |
Eurybia divaricata Weiße Waldaster
Eurybia macrophylla Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
Eurybia sibirica Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster
 Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) ist wieder mal so ein typischer Fall von Mitleidheischen im Pflanzenreich: Jahrelang haben wir sie gehätschelt und gepäppelt, denn sie wollte und wollte nicht wachsen. Dann ging alles ratzfatz, die Großblättrige Aster ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat mit einem Schlag mit ihrem unterirdischen Rhizom (ein mehr oder weniger stark verdickt wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) das ganze Beet eingenommen. Schön blöd. Am Ende musste Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) von diesem Standort sicherheitshalber komplett weichen, als das Beet neu gestaltet wurde. Jedenfalls ist es nicht verwunderlich, dass sie sich in Deutschland inzwischen in ein paar Gegenden Naturstandorte erobert hat und ein eingebürgerter Neophyt ist. Ob es wohl stimmt, dass sich diese Aster nicht einmal vom Giersch (Aegopodium podagraria) verdrängen lässt? Ich kann es leider, aber auch glücklicherweise nicht überprüfen, weil Giersch eines der wenigen Unkräuter ist, das ich nicht habe.
Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) ist wieder mal so ein typischer Fall von Mitleidheischen im Pflanzenreich: Jahrelang haben wir sie gehätschelt und gepäppelt, denn sie wollte und wollte nicht wachsen. Dann ging alles ratzfatz, die Großblättrige Aster ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat mit einem Schlag mit ihrem unterirdischen Rhizom (ein mehr oder weniger stark verdickt wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) das ganze Beet eingenommen. Schön blöd. Am Ende musste Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) von diesem Standort sicherheitshalber komplett weichen, als das Beet neu gestaltet wurde. Jedenfalls ist es nicht verwunderlich, dass sie sich in Deutschland inzwischen in ein paar Gegenden Naturstandorte erobert hat und ein eingebürgerter Neophyt ist. Ob es wohl stimmt, dass sich diese Aster nicht einmal vom Giersch (Aegopodium podagraria) verdrängen lässt? Ich kann es leider, aber auch glücklicherweise nicht überprüfen, weil Giersch eines der wenigen Unkräuter ist, das ich nicht habe.
 Schön an der Herzblättrigen Aster sind ihre hochsommerliche Blütezeit sowie die auffälligen rötlichen, leicht kantigen Stängel. Positiv an ihr ist auch, dass sie – zumindest in unserem schweren Lehmboden – nicht durch übermäßige Selbstaussaat unangenehm auffällt. Ihre Ausläufer lassen sich nämlich (wenn man's vorher weiß) mit einer Rhizom- bzw. Wurzelsperre (z. B. aus stabiler Teichfolie) im Zaum halten und deshalb braucht niemand auf sie zu verzichten.
Schön an der Herzblättrigen Aster sind ihre hochsommerliche Blütezeit sowie die auffälligen rötlichen, leicht kantigen Stängel. Positiv an ihr ist auch, dass sie – zumindest in unserem schweren Lehmboden – nicht durch übermäßige Selbstaussaat unangenehm auffällt. Ihre Ausläufer lassen sich nämlich (wenn man's vorher weiß) mit einer Rhizom- bzw. Wurzelsperre (z. B. aus stabiler Teichfolie) im Zaum halten und deshalb braucht niemand auf sie zu verzichten.
Weniger positiv ist, dass Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) nicht so furchtbar üppig blüht und zudem relativ kleine Einzelblüten hat. Gut ist sie daher in großen Gärten mit Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
aufgehoben. Oder aber in lichten Hecken und an Gehölzrändern, wo sie ihre Vorzüge voll und ganz ausspielen kann: Ihre Rosetten mit den großen, dunkelgrünen Blättern sind prima Bodendecker! An solchen Standorten wird ihr Breitenwachstum automatisch gebremst, denn es bleibt meistens nicht gar so viel Wasser für die Aster übrig, weil die Gehölze den Löwenanteil beanspruchen; solange es nicht zu trocken wird, hält Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) dem Wurzeldruck der Gehölze stand.
 Mit den passenden Stauden um sie herum kann eine Herzblättrige Aster natürlich auch im Beet ein richtiger Hingucker sein. Bei ihr kommt es allerdings weniger auf die direkte Nachbarschaft an als auf die Fernwirkung. Ein schönes Bild ergibt sich etwa mit der wuchtigen Riesen-Hänge-Segge (Carex pendula) im Hintergrund oder mit dem kompakten Berg-Reitgras (Calamagrostis varia). Nicht nur in Beetsituationen macht sich zudem der Wald-Geißbart (Aruncus dioicus) gut hinter, neben und mit der Herzblättrigen Aster, das ist auch eine schöne Kombination für nicht zu trockene Gehölzränder, beispielsweise Hecken.
Mit den passenden Stauden um sie herum kann eine Herzblättrige Aster natürlich auch im Beet ein richtiger Hingucker sein. Bei ihr kommt es allerdings weniger auf die direkte Nachbarschaft an als auf die Fernwirkung. Ein schönes Bild ergibt sich etwa mit der wuchtigen Riesen-Hänge-Segge (Carex pendula) im Hintergrund oder mit dem kompakten Berg-Reitgras (Calamagrostis varia). Nicht nur in Beetsituationen macht sich zudem der Wald-Geißbart (Aruncus dioicus) gut hinter, neben und mit der Herzblättrigen Aster, das ist auch eine schöne Kombination für nicht zu trockene Gehölzränder, beispielsweise Hecken.
Eurybia macrophylla – Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
| Wuchshöhe: | 35-100 cm |
| Blütenfarbe: | weiß bis violett (variabel) |
| Blütezeit: | August, September (Oktober) |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | eingebürgerter Neophyt |
Eurybia divaricata Weiße Waldaster
Eurybia macrophylla Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
Eurybia sibirica Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster
 Anspruchslos, was den Boden anbelangt, das ist eine Eigenschaft der Arktischen Aster, die immer wieder hervorgehoben wird. Dem kann ich zustimmen, möchte jedoch den Satz mit dem Hinweis ergänzen, dass das reine Gedeihen/
Anspruchslos, was den Boden anbelangt, das ist eine Eigenschaft der Arktischen Aster, die immer wieder hervorgehoben wird. Dem kann ich zustimmen, möchte jedoch den Satz mit dem Hinweis ergänzen, dass das reine Gedeihen/
In leichten Böden (sandig, kiesig, humos – das scheint sie zu bevorzugen) bildet Eurybia sibirica (Aster sibiricus) recht schnell einen dichten Teppich, während sie sich in schweren (Lehm-)Böden (damit arrangiert sie sich) – wie bei mir im Garten – nur langsam und weniger dicht ausbreitet. Als Bodendecker ist sie trotz dieser Einschränkung zu gebrauchen.

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) – Ausläufer
Die Empfehlung, Eurybia sibirica (Aster sibiricus) im Steingarten mit seinem durchlässigen, sandig-steinigen Substrat anzusiedeln, ist daher aus meiner Sicht etwas zu leichtfertig, denn dort muss man ihr Wuchsverhalten, ihre unterirdischen Ausläufer, stets im Blick behalten, damit empfindliche(re) Mitbewohner nicht bedrängt und gestört werden. Wenn Steingarten, dann also bloß größere bis große Steinanlagen, in denen der Polaraster ein ausreichend dimensionierter Pflanzplatz für ihre ungestörte Entwicklung zugestanden werden kann; eventuell am Fuß des Steingartens, vielleicht auf der Ost- oder Westseite, denn diese Aster verträgt Halbschatten gut (deshalb auch nur Morgen- oder Abendsonne).

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) Mitte August
Ein wenig unscheinbar ist die Sibirische Aster schon, selbst zur Blütezeit, weil sie halt "so weit unten" ist und kaum höher als 30 cm wird. Sie sollte daher stets eine "Randerscheinung" (Gehölzrand, Beetrand, Einzelstellung) sein, egal, wohin man sie pflanzt. Inmitten anderer – höherer – Stauden und Ziergräser ginge sie einfach unter, obwohl ihre Blütenköpfe verhältnismäßig (im Verhältnis zur Gesamtgröße) groß sind und die Blütenstiele mit ihrer (in der Regel und zumindest zum Teil) rötlichen Färbung ganz nett sind. Und wann blüht die Arktische Aster jetzt eigentlich? Die Hauptblütezeit ist definitiv im Juni. Sie erstreckt sich bis in den Juli, ein paar Nachzügler-Blüten hat man mitunter noch im August. Aber dann ist Schluss. Wie es zu Aussagen wie "August bis September" kommt, kann ich nur vermuten: Eventuell beginnt Eurybia sibirica an den Naturstandorten etwas später zu blühen (und blüht dafür etwas länger), weil so hoch im Norden ja das Frühjahr später beginnt und dadurch die Vegetationsphase nach hinten geschoben wird; diese Angaben hat man dann "blind" übernommen, anstatt sie in anderen Regionen erst einmal zu prüfen. Das wäre möglich, ist jedoch nicht sicher.

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) – Austrieb
Sicher ist aber, dass die Polaraster am besten auf größeren Flächen wirkt, und wer kann, der sollte daher wenigstens einen halben Quadratmeter für sie reservieren. Auf so einer Fläche sollten Sie fünf Exemplare im Abstand von 30‑40 cm zueinander pflanzen. Das wird dann schon dicht. Meine Einzelstücke machen jedenfalls selbst nach vier Jahren noch nicht besonders viel her.
Ist die Polaraster überhaupt winterhart? Ja, in ihrem Fall halten die deutschen Namen Arktische oder Sibirische Aster und Polaraster, was sie versprechen. Wer so weit im Norden wohnt (u. a. Nord-Russland, Sibirien, Norwegen) wie Eurybia sibirica (Aster sibiricus), der kommt mit unseren mitteleuropäischen Wintern selbstverständlich problemlos zurecht, zumal wenn er sommergrün ist und im Herbst einzieht.
Eurybia sibirica – Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster
| Wuchshöhe: | 10-30 cm |
| Blütenfarbe: | hell violett |
| Blütezeit: | (Mai) Juni, Juli (August) |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: |
Zum Seitenanfang
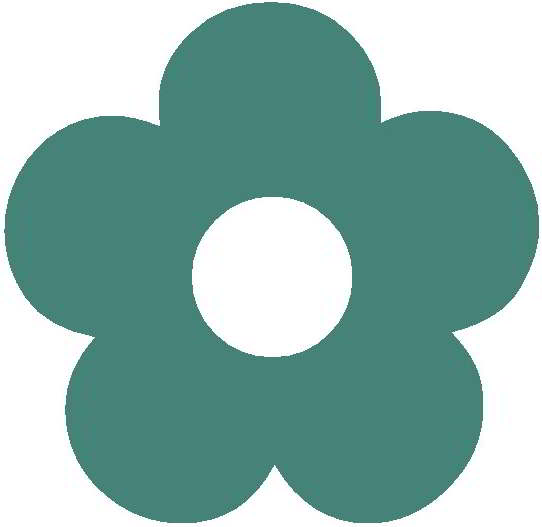
Weitere Staudengattungen
Achillea (Schafgarbe)
Acinos (Steinquendel)
Aconitum (Eisenhut)
Aconogonon (Bergknöterich)
Agastache (Duftnessel)
Ajuga (Günsel)
Alcea (Stockrose)
Alchemilla (Frauenmantel)
Althaea (Eibisch)
Alyssum (Steinkraut)
Amsonia (Blausternbusch)
Anaphalis (Perlkörbchen)
Androsace (Mannsschild)
Anemone (Anemone)
Antennaria (Katzenpfötchen)
Anthericum (Graslilie)
Aquilegia (Akelei)
Arabis (Gänsekresse)
Aralia (Aralie)
Arenaria (Sandkraut)
Armeria (Grasnelke)
Artemisia (Silberraute)
Aruncus (Geißbart)
Asphodeline (Junkerlilie)
Aster (Aster)
Astrantia (Sterndolde)
Aurinia (Steinkresse)
Baptisia (Indigolupine)
Bergenia (Bergenie)
Brunnera (Kaukasusvergissmeinnicht)
Buglossoides (Steinsame)
Calamintha (Bergminze)
Campanula (Glockenblume)
Centaurea (Flockenblume)
Cephalaria (Schuppenkopf)
Chamaemelum (Römische Kamille)
Chrysanthemum (Chrysantheme)
Clematis (Waldrebe)
Clinopodium (Bergminze)
Coreopsis (Mädchenauge)
Cymbalaria (Zimbelkraut)
Datisca (Scheinhanf)
Delphinium (Rittersporn)
Dianthus (Nelke)
Dictamnus (Diptam)
Digitalis (Fingerhut)
Dracocephalum (Drachenkopf)
Dryas (Silberwurz)
Echinacea (Scheinsonnenhut)
Echinops (Kugeldistel)
Echium (Natternkopf)
Epilobium (Weidenröschen)
Eryngium (Edeldistel, Mannstreu)
Euphorbia (Wolfsmilch)
Eurybia (Aster)
Filipendula (Mädesüß)
Gaillardia (Kokardenblume)
Galatella (Aster)
Gaura (Prachtkerze)
Gentiana (Enzian)
Geranium (Storchschnabel)
Geum (Nelkenwurz)
Gillenia (Dreiblattspiere)
Gypsophila (Schleierkraut)
Helenium (Sonnenbraut)
Helianthemum (Sonnenröschen)
Helianthus (Sonnenblume)
Heliopsis (Sonnenauge)
Helleborus (Christrose, Nieswurz)
Hemerocallis (Taglilie)
Herniaria (Bruchkraut)
Heuchera (Purpurglöckchen)
Hosta (Funkie)
Hypericum (Johanniskraut)
Hyssopus (Ysop)
Iberis (Schleifenblume)
Jasione (Sandglöckchen)
Kalimeris (Schönaster)
Knautia (Witwenblume)
Kniphofia (Fackellilie)
Lamium (Goldnessel)
Lavandula (Lavendel)
Leonurus (Herzgespann)
Leucanthemum (Garten-Margerite)
Liatris (Prachtscharte)
Ligularia (Goldkolben)
Limonium (Strandflieder, Meerlavendel)
Linaria (Leinkraut)
Linum (Lein)
Lithospermum (Steinsame)
Lupinus (Lupine)
Lychnis (Lichtnelke)
Lysimachia (Felberich)
Lythrum (Weiderich)
Malva (Malve)
Melissa (Melisse)
Mentha (Minze)
Monarda (Indianernessel)
Nepeta (Katzenminze)
Oenothera (Nachtkerze)
Oligoneuron (Aster)
Origanum (Dost, Oregano, Majoran)
Paeonia (Pfingstrose)
Papaver (Mohn)
Penstemon (Bartfaden)
Petrorhagia (Felsennelke)
Phlomis (Brandkraut)
Phlox (Flammenblume)
Platycodon (Ballonblume)
Polemonium (Jakobsleiter)
Polygonatum (Salomonssiegel)
Potentilla (Fingerkraut)
Primula (Aurikel, Schlüsselblume, Primel)
Prunella (Braunelle)
Pseudofumaria (Lerchensporn)
Pulmonaria (Lungenkraut)
Pulsatilla (Kuh-/Küchenschelle)
Rudbeckia (Sonnenhut)
Ruta (Raute)
Salvia (Salbei)
Sanguisorba (Wiesenknopf)
Saponaria (Seifenkraut)
Satureja (Bohnenkraut)
Saxifraga (Steinbrech)
Scabiosa (Skabiose)
Sedum (Fetthenne)
Sempervivum (Hauswurz)
Sideritis (Bergtee)
Silene (Leimkraut)
Solidago (Goldrute)
Stachys (Ziest)
Symphyotrichum (Aster)
Symphytum (Beinwell)
Tanacetum (Bunte Margerite)
Teucrium (Gamander)
Thalictrum (Wiesenraute)
Thymus (Thymian)
Tiarella (Schaumblüte)
Tradescantia (Dreimasterblume)
Trifolium (Klee)
Trollius (Trollblume)
Verbascum (Königskerze)
Verbena (Verbene)
Vernonia (Scheinaster)
Veronica (Ehrenpreis)
Veronicastrum (Arzneiehrenpreis)
Vinca (Immergrün)
Viola (Veilchen)
Waldsteinia (Waldsteinie)
Yucca (Palmlilie)
Eurybia divaricata Weiße Waldaster
Eurybia macrophylla Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
Eurybia sibirica Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster

 größeres Bild
größeres Bild
