Aster – Aster
Eine Aster ist eine Aster ist eine Aster …
(Pflanzenfamilie: Asteraceae – Korbblütler)
Die Gattung Aster wurde in Nordamerika vor einiger Zeit "auseinandergenommen", und die Botaniker haben geprüft, ob tatsächlich alle Arten korrekt zugeordnet, also alles Astern sind, was sich in der Gattung tummelt. Und siehe da: sind sie nicht! Vor allem unter Berücksichtigung molekularbiologischer Untersuchungen ergaben sich etliche Änderungen. Manche Arten wurden infolgedessen in andere Gattungen verlagert.

Symphyotrichum laeve, ehedem Aster laevis (Glatte Aster)
Insbesondere "der Zander" (Handwörterbuch der Pflanzennamen 2014, ISBN 978-3-8001-7953-4) scheint sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dass die Molekularbiologie auch Einzug in die Pflanzenbestimmung gehalten hat, und richtet sich nach wie vor nur nach dem, was man mit dem Auge (und notfalls einer Lupe) erkennen kann. Ein gern verwendetes Argument gegen Umgruppierungen von Pflanzengattungen und ‑arten sind die Gärtner, die nicht durcheinandergebracht werden sollen und denen zusätzlicher Aufwand erspart werden soll. Frage: Was könnte einen mehr durcheinanderbringen als ein Durcheinander? Als uneinheitliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Pflanze in einer globalisierten Welt?
Hier jedenfalls einige Änderungen, die die hier vorgestellten Astern betreffen, nur für den Fall, dass ihnen diese botanischen Namen bei einem Staudengärtner mit dem Mut zu Neuem und zur Entscheidung begegnen:
| Alter Name | Deutscher Name | Neuer Name |
| Aster alpinus | Alpen-Aster | Aster alpinus |
| Aster amellus | Berg-Aster, Kalk-Aster | Aster amellus |
| Aster azureus | Himmelblaue Aster | Symphyotrichum oolentangiense |
| Aster divaricatus | Weiße Wald-Aster | Eurybía divaricata |
| Aster dumosus | Kissen-Aster, Buschige Aster |
Symphyotrichum dumosum |
| Aster ericoides | Myrthen-Aster, Erika-Aster |
Symphyotrichum ericoides |
| Aster laevis | Glatte Aster, Kahle Aster |
Symphyotrichum laeve |
| Aster linosyris | Goldhaar-Aster, Gold-Aster, Steppen-Aster, Gold-Steppen-Aster, Goldschopf |
Galatella linosyris |
| Aster macrophyllus | Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster |
Eurybía macrophylla |
| Aster novae-angliae | Raublatt-Aster, Neuengland-Aster |
Symphyotrichum novae-angliae |
| Aster novi-belgii | Glattblatt-Aster, Neubelgien-Aster |
Symphyotrichum novi-belgii |
| Aster ptarmicoides | Weiße Goldrute, Weiße Hochland-Aster |
Solidago ptarmicoides |
| Aster pyrenaeus | Pyrenäen-Aster | Aster pyrenaeus |
| Aster sedifolius | Sedumblättrige Aster | Galatella sedifolia |
 Die deutschen Namen wurden an diese Änderungen freilich noch nicht angepasst. So weit sind wir noch lange nicht. Es könnte natürlich sein, dass man der Vertrautheit halber bei Aster bleibt. Auch dies bedarf aber halt einer Entscheidung.
Die deutschen Namen wurden an diese Änderungen freilich noch nicht angepasst. So weit sind wir noch lange nicht. Es könnte natürlich sein, dass man der Vertrautheit halber bei Aster bleibt. Auch dies bedarf aber halt einer Entscheidung.
Was letztlich von der einst so umfangreichen Gattung Aster übrig bleibt, lässt sich (noch) nicht sagen. Man steckt schließlich noch mittendrin in der Arbeit. Eines steht jedoch schon fest: Nur die engsten Verwandten von Aster amellus (Berg-Aster, Kalk-Aster) werden es sein.
Immer wieder tauchen die Begriffe "Naturgarten", "naturnaher Garten" oder "Wildstaudenpflanzungen" auf. Was man sich darunter vorstellen muss, will ich daher kurz erklären, denn bei den Astern nebst ehemaligen solchen werden Sie diesen Begriffen häufiger begegnen:
Naturgarten:
Ein Garten, der ausschließlich mit einheimischen Pflanzen angelegt ist.
Naturnaher Garten:
Ein Garten, der weitgehend unter Verwendung von einheimischen Pflanzen angelegt ist.
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstaudenpflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.

Halictus scabiosae (Gelbbindige Furchenbiene, Weibchen) auf Aster pyrenaeus 'Lutetia' (Pyrenäen-Aster)
Noch etwas: So beliebt, wie Astern bei Insekten als Nektarquelle sind, sollte man doch meinen, dass sie auch ein wunderbarer Pollenlieferant für Wildbienen und deren Larven sind. Weit gefehlt – Paul Westrich belehrt uns in seinem Buch "Die Wildbienen Deutschlands" (Verlag Eugen Ulmer 2018, Stuttgart, ISBN 978-3-8186-0123-2) eines Besseren: Die Insektenkundler haben Pollen von nur drei Astern-Arten (von denen zwei nach der neuen Nomenklatur gar nicht mehr zu den Astern gehören) als Proviant für Wildbienen-Larven belegt: von Aster amellus, Aster linosyris (heute Galatella linosyris) und Aster novae-angliae (inzwischen Symphyotrichum novae-angliae). Wer dieses Thema vertiefen möchte, dem empfehle ich die Lektüre meines Artikels über Wildbienen im Stauden-Garten.
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Aster alpinus (Alpen-Aster) mit Honigbiene
Ein Steingarten wäre schon der optimale Standort für die Alpen-Aster, denn sie braucht sonnige und zugleich kühle Lagen in magerem (vor allem stickstoffarmem) und sehr durchlässigem Boden. In Deutschland ist sie in den Alpen noch recht häufig in der Natur zu finden, bei den wenigen verstreuten Bestände im Harz sowie im Thüringer Wald hingegen sieht es in den Bundesländer Sachsen-Anhalt (extrem selten) und Thüringen (stark gefährdet) bereits bedenklich aus. Unter besonderem Schutz steht Aster alpinus an allen Naturstandorten in Deutschland (Stand Februar 2025).

Hochgewachsene Aster alpinus (Alpen-Aster) beim Austrieb
Damit Aster alpinus langlebig ist und hübsche Polster bildet, braucht sie ein bisschen Pflege: Die Pflanzen müssen nach der Blüte zurückgeschnitten werden, weil sie sonst "hochwachsen" (quasi aus ihrem Pflanzplatz heraus) und von unten verkahlen. Das kann zum Totalausfall führen. Sollte die Sache mit dem Rückschnitt in Vergessenheit geraten sein und eine Alpen-Aster hochwachsen, gibt es zwei Möglichkeiten der Rettung: Die Pflanze aufnehmen und an gleicher oder anderer Stelle neu sowie tiefer pflanzen oder die hochgewachsenen Triebe mit Erde anhäufeln. Derart angefüllte Triebe bilden recht schnell Wurzeln und ermöglichen es, die Pflanze zu teilen. Um Aster alpinus zu vermehren, kann man ihre Triebe also auch absichtlich hochwachsen lassen, anfüllen und später die bewurzelten Triebe abtrennen.
Aster alpinus gehört zu den am frühesten im Jahr blühenden Astern, das macht sie für die Gartengestaltung so wichtig. Sie kann zu vielen frühjahrs- und frühsommerblühenden Stauden gesellt werden, denn es gibt sie mit Blüten in verschiedenen Violetttönen, in Rosa und Weiß (rosa und weiß sind vornehmlich als Sorten im Angebot, meist aus Samen vermehrt).
Aster alpinus – Alpen-Aster
| Wuchshöhe: | 20-35 cm |
| Blütenfarbe: | rosa |
| Blütezeit: | Mai, Juni |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Steingarten |
| Hinweis: | wichtig: im Garten hochgewachsene Triebe mit Erde anfüllen |
Aster alpinus – Alpen-Aster
| Wuchshöhe: | 20-35 cm |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | Mai, Juni |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Steingarten |
| Hinweis: | wichtig: hochgewachsene Triebe mit Erde anfüllen |

Violette Alpen-Astern – heller oder dunkler im Farbton – passen sowohl zu Pflanzen in der gleichen Farbe wie auch zu Pflanzen in Kontrastfarben. In unserem Steingarten sehen Sie das sehr schön, wenn sie mit Baptisia australis var. minor (Kleine Indigolupine) und Alyssum murale (Mauer-Steinkraut) gleichzeitig blühen – die drei sind inzwischen richtig "gute Freunde" geworden.
Ob ein Farbton heller oder dunkler empfunden wird, entscheidet unser Auge übrigens meist nach Wetterlage: Dunkler wirkt er an trüben Tagen, heller an sonnigen Tagen. Wer kräftige Farben liebt, ist deshalb mit einem Einkaufsbummel bei sonnigem Wetter meist besser bedient.
Aster alpinus – Alpen-Aster
| Wuchshöhe: | 20-35 cm |
| Blütenfarbe: | dunkelviolett |
| Blütezeit: | Mai, Juni |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Steingarten |
| Hinweis: | wichtig: hochgewachsene Triebe mit Erde anfüllen |
Aster alpinus – Alpen-Aster
| Wuchshöhe: | 20-35 cm |
| Blütenfarbe: | violett |
| Blütezeit: | Mai, Juni |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Steingarten |
| Hinweis: | wichtig: hochgewachsene Triebe mit Erde anfüllen |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
Aster amellus ist der Prototyp dessen, was den botanischen Namen Aster tragen darf: Nur wer eng mit ihr verwandt ist, gehört auch in diese Gattung. Und weil im Zuge der Änderungen und Neuordnung in der Gattung Aster jetzt genauer hingesehen wird, müssen all diejenigen Pflanzen in andere Gattungen ausweichen, die eigentlich nie hätten Astern sein dürfen – weil sie nicht nah genug mit Aster amellus verwandt sind.

Grandioses Trio: Aster amellus, Salvia officinalis 'Tricolor', Nassella tenuissima
Die Berg-Aster schließt die Lücke zwischen den Frühlings- und den Herbst-Astern und sorgt damit dafür, dass im (Stein-)
Genau dort – und das ist nun mal meist der (kalkhaltige) Steingarten –, wo sie trockenen, stickstoffarmen Boden mit gutem Wasserabzug findet, ist Aster amellus am langlebigsten und macht am wenigsten Probleme. Vollsonnig sollte der Standort noch sein, gern ein schönes Eckchen, in dem die Wärme gespeichert wird (womit wir wieder beim "Stein" wären). Pflanzen sollte man am besten vom Frühjahr bis zum Frühsommer, jedenfalls nicht erst im Herbst, da ist die Ausfallquote zu hoch.

Aster amellus (Berg-Aster, Kalk-Aster) – Austrieb
Wer der Berg-Aster diese Anforderungen an einem Platz im Staudenbeet erfüllen kann, wird sie dort ebenfalls als ausdauernd erleben. Stimmt auch nur einer der Faktoren nicht, verliert man sie nach kurzer Zeit (ein paar Jahren).
In Gärten, in denen jedes Beet und jede Pflanzengemeinschaft ausgeklügelt ist, dürfte es die reine Art der Berg-Aster mit diesen Eigenschaften nicht schaffen, zumal sie sehr locker wächst und damit nur wenig mit einer der üppigen Prachtstauden gemeinsam hat. Besitzern solcher Gärten rate ich als Alternative zu den vielen Sorten von Aster amellus, die in der Regel kompakter wachsen und voller blühen als die Art.
Ein Fall für Naturgarten-Fans: die Kalk-Aster

Große Sumpfschwebfliege auf Aster amellus (Berg-Aster, Kalk-Aster)
Gartler mit einem Hang zu Überraschungen und Veränderungen werden von der Art, nicht von den Sorten der Kalk-Aster begeistert sein. Für diesen Gärtner-Typ spielt es ja keine so große Rolle, ob eine Pflanze recht ausdauernd ist, Hauptsache, sie ist da – wo, ist erst mal zweitrangig. Und damit kann Aster amellus dienen: Wenn man sie aussamen lässt, also Verblühtes nicht vor der Samenreife abschneidet, bleibt sie einem Garten über Jahrzehnte hinweg erhalten, meist fallen und keimen die Samen sogar nah bei der Mutterpflanze. Wobei: Aster amellus lässt uns fast keine andere Wahl, als sie aussamen zu lassen. Ihrer langen Blütezeit ist nämlich geschuldet, dass sie bereits erste Samen ausbildet, während stetig neue Blüten erscheinen. Und wer greift da schon zur Schere? Dazu kommt: Schneidet man Blütenstiele der Berg-Aster ab, schalten diese umgehend in den Notreife-Modus. Es bilden sich blitzschnell keimfähige Samen – auch wenn sie schon auf dem Kompost entsorgt sind.

Aster amellus (Berg-Aster, Kalk-Aster) – Blüten und Samen
In Naturgärten
Naturgarten:
Ein Garten, der ausschließlich mit einheimischen Pflanzen angelegt ist.
, naturnahen Anlagen
Naturnaher Garten:
Ein Garten, der weitgehend unter Verwendung von einheimischen
Pflanzen angelegt ist.
und Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
darf die einheimische Aster amellus aus all diesen Gründen auf gar keinen Fall fehlen (schon allein deshalb nicht, weil die Berg-Aster Raupenfutterpflanze für eine Eulen- sowie eine Spanner-Art ist). Dort braucht es auch keine der vielen Sorten, nur die reine Art mit ihren lockeren, hell violettblauen Blütenständen. Als Nahrung für die Larven ist der Pollen der Berg-Aster übrigens nur bei einer einzigen Wildbienen-Art belegt: Osmia spinulosa (Bedornte Mauerbiene, wegen der kleinen Dornen am Schildchen). Im Norden Deutschlands kommt diese Mauerbiene nur hie und da vor, in den südlichen Teilen ist sie einigermaßen häufig, besonders in den gebirgigeren Gegenden (in den Alpen ist sie bis in 2.000 m Höhe anzutreffen). Osmia spinulosa sammelt für ihre Larven ausschließlich Pollen von Korbblütlern (Asteraceae), daher machen sie ihr eine große Freude, wenn im Garten während ihrer Flugzeit von Anfang Juni bis Mitte August auch Alant-Arten (Inula) oder Flockenblumen (Centaurea) zum Beispiel blühen und zudem leere kleine Schneckenhäuser rumliegen, in die sie ihre Nester bauen kann.

Heriades truncorum (Weibchen) bei Pollensammeln auf Aster amellus (Berg-Aster, Kalk-Aster)
Belegt hin oder her – bei mir im Garten konnte ich die Gewöhnliche Löcherbiene (Heriades truncorum) ebenfalls beim Pollensammeln (nur die Bienenweibchen sammeln) auf Aster amellus beobachten. Dieses kleine Bienchen ist noch häufig und weit verbreitet und es ist – wie die genannte Mauerbiene – auf Pollen von Korbblütlern (Asteraceae) als Larvenproviant fixiert. Eigentlich erstaunlich, dass Pollen der einheimischen Berg-Aster nicht in Nestern von mehr Wildbienen-Arten gefunden wurde, wo es doch so viele gibt, die an Korbblütlern sammeln. Es könnte damit zu tun haben dass sich Aster amellus in der Natur immer rarer bei uns macht. Bis auf Thüringen sahen sich nämlich alle Bundesländer, in denen Aster amellus noch am Naturstandort vorkommt, bereits genötigt, sie als (mehr oder minder stark) gefährdet einzustufen; mittlerweile gilt sie auch bundesweit betrachtet als gefährdet (Stand Februar 2025).
Aster amellus – Berg-Aster, Kalk-Aster
| Wuchshöhe: | 30-70 cm |
| Blütenfarbe: | hellviolett |
| Blütezeit: | Juli, August, September |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Steingarten |
| Hinweis: | kalkreicher Boden; Pollenquelle für Wildbienen |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Links: Aster pyrenaeus 'Lutetia' (Pyrenäen-Aster)
Rechts: Aster amellus (Berg-Aster)
Die reine Art Aster pyrenaeus ist selten – wenn überhaupt – im Angebot der Staudengärtnereien. Meist findet man die Sorte 'Lutetia' und das nicht ohne Grund: 'Lutetia' besticht mit einer reichen Blüte, sie wächst buschig und stark. Durchaus zu empfehlen also.
Die Pyrenäen-Aster (in den Pyrenäen ist sie beheimatet) und die Berg-Aster (Aster amellus) unterscheiden sich wenig, und wo die eine hinpasst, fühlt sich auch die andere wohl. Die großen Blüten, die zarte Blütenfarbe sowie die etwas spätere Blütezeit könnten jedoch so manchen dazu verleiten, sich für 'Lutetia' zu entscheiden, zumal beide Arten horstig wachsen und ihre Standortansprüche wie gesagt ähnlich sind: Beide lieben es sonnig, vertragen Trockenheit und bevorzugen kalkhaltigen Boden.

Aster pyrenaeus 'Lutetia' (Pyrenäen-Aster) – Austrieb
Besitzer kleinerer Gärten sollten allerdings berücksichtigen, dass die Pyrenäen-Aster erheblich stärker wächst als die Berg-Aster und zudem etwas höher wird. Andererseits sät sich die Berg-Aster überreich aus (und keimt im Garten), so man sie lässt, und damit ist die Pyrenäen-Aster in meinem Garten in all den Jahren noch gar nicht (unangenehm) aufgefallen.

Verkahlte Aster pyrenaeus (Pyrenäen-Aster)
Wer im Garten den Platz dafür hat, sollte beiden Astern ein Zuhause geben und sich die Wahl sparen. Aster pyrenaeus wird übrigens nachgesagt, robuster und langlebiger zu sein als Aster amellus. Langlebiger vielleicht, aber robuster? Nein, das hätte ich bemerkt. Trockenheitsverträglicher ist jedenfalls A. amellus, denn die Horste von A. pyrenaeus neigen dazu, bei länger anhaltender Trockenheit auseinanderzufallen. Ebenfalls zu lang andauernder Trockenheit ist es geschuldet, wenn die Blätter der Pyrenäen-Aster von unten nach oben vertrocknen und die Stängel verkahlen. Das kenne ich von der Berg-Aster nicht!
Weil zu viel Einigkeit offenbar als uncool erachtet wird, stellt der Autor P. Picton in seinem "The Gardener's Guide to Growing Aster" (2004) die Sorte 'Lutetia' übrigens zu Aster amellus, nicht zu Aster pyrenaeus. Das habe ich bei der Royal Horticultural Society (RHS – England) im Artikel "The Splitting of Aster" entdeckt, der leider nicht mehr veröffentlicht ist.
Aster pyrenaeus 'Lutetia' – Pyrenäen-Aster
| Wuchshöhe: | 70-80 cm |
| Blütenfarbe: | zart lila |
| Blütezeit: | August, September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: |
Eurybia – Großblattaster
(Pflanzenfamilie: Asteraceae – Korbblütler)
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Sämling von Eurybia divaricata (Weiße Waldaster)
In die Gattung Eurybía (Betonung auf dem "i") wurden vor einiger Zeit mehrere Astern-Arten (Heimat: Nordamerika sowie nördliches Eurasien) aus der Gattung Aster ausgegliedert, die alle ein Rhizom und entweder eiförmige bis spatelförmige Blätter mit konischer oder V-förmiger Blattbasis (Eurybia sibirica etwa, die Arktische oder Sibirische Aster) haben oder große, herzförmige bis annähernd dreieckige Grundblätter, die eine Art Rosette bilden (Eurybia divaricata [Weiße Waldaster]) und Eurybia macrophylla [Herzblättrige Aster] zum Beispiel). Die Arten in der Gattung Eurybia haben während der Blüte eine gelbe Blütenscheibe (Körbchen); verblühte Blüten erkennt man an der purpurfarbenen Scheibe (purpurrot, purpurviolett, so in die Richtung).
Mit ihrem Rhizom (ein Rhizom ist ein mehr oder weniger stark verdickter, meist unterirdisch wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) breiten sich einige der durch die Bank staudigen, also winterharten, mehrjährigen Arten dieser Gattung aus (stärker oder schwächer). Das sollte für niemanden ein Grund sein, sie zu meiden: Eine Wurzelsperre aus stabiler Teichfolie oder sogar nur einem großen Plastikkübel mit Löchern im Boden, die/

Eurybia divaricata (Weiße Waldaster) – Sämling
Aus den USA kam einst die Weiße Waldaster nach Europa, wo sie mittlerweile als eingebürgert gilt.
Eurybia divaricata (Aster divaricatus) verträgt unter den Astern am meisten Schatten und ist zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet. Sie sät sich wie Symphyotrichum oolentangiense (Aster azureus – Himmelblaue Aster) oder Symphyotrichum laeve (Aster laevis – Glatte oder Kahle Aster) gern aus (in der neuen Gattung Symphyotrichum sind die Herbstastern zusammengefasst). Mitunter keuzt sie sich zudem mit anderen Astern-Arten und passt mit diesen Eigenschaften gut in eine Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
. Wo eine Selbstaussaat der Weißen Waldaster unerwünscht ist, müssen verblühte Blütentriebe unbedingt vor der Samenreife abgeschnitten werden.
Meine Meinung: eine der schönsten hohen Spätsommerastern. Nicht nur wegen ihrer vielen filigranen weißen, leicht rosa überlaufenen Blüten, vor allem wegen ihrer außergewöhnlichen purpurfarbenen Stängel. Dass die Weiße Waldaster mit ihren großen, fast herzförmigen Grundblättern das Zeug zum Bodendecker hat, macht sie für viele Gartengestaltungen noch interessanter.

Eurybia divaricata (Weiße Waldaster) mit Stipa calamagrostis (Silberährengras)
Eurybia divaricata (Aster divaricatus) hat sich bei uns im Garten über die Jahre als relativ standfest erwiesen. Ein magerer, wenig gedüngter Standort ist für einen stabilen Wuchs der Weißen Waldaster empfehlenswert, und da Lehmboden – wie hier im Garten – von vornherein eher nährstoffreich ist, spricht das für ihre Standfestigkeit.
Hier noch ein paar Stauden und Gräser, mit denen sich als Begleiter dieser Aster stimmungsvolle Arrangements zaubern lassen: Vernonia arkansana (Arkansas-Scheinaster), Gaura lindheimeri (Prachtkerze), hohe Phlox-Arten (Phlox, Flammenblume) oder Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis) und als Ziergräser Panicum virgatum (Echte Rutenhirse, eventuell in Sorten) und Stipa calamagrostis (Alpen-Raugras, Silberährengras).
Hinweis: In vielen Beschreibungen ist die Rede davon, dass sich diese Aster (stark) ausbreitet (Ausläufer/
- Ich kultiviere gar keine Eurybia divaricata, sondern eine andere, äußerlich der Weißen Waldaster sehr ähnliche Art.
- Die Autoren/
Autorinnen irren sich (Fachliteratur und World Wide Web); das kann schon mal passieren, wenn derjenige/ diejenige mit einer Aussage falsch liegt, von dem/ der die meisten anderen ihr Wissen beziehen ("abschreiben“) – in der Literatur ebenso wie im Netz. - Es hängt mit dem Boden zusammen, ob und wie stark sich Eurybia divaricata ausbreitet. In diesem Fall hätten die Autoren recht und ich trotzdem Weiße Waldastern im Garten.
Eurybia divaricata – Weiße Waldaster
| Wuchshöhe: | 40-100 cm |
| Blütenfarbe: | weiß, oft rosa bis violett überhaucht |
| Blütezeit: | August, September |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch-mäßig trocken |
| Verwendung: | Schnittpflanze |
| Hinweis: |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
 Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) ist wieder mal so ein typischer Fall von Mitleidheischen im Pflanzenreich: Jahrelang haben wir sie gehätschelt und gepäppelt, denn sie wollte und wollte nicht wachsen. Dann ging alles ratzfatz, die Großblättrige Aster ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat mit einem Schlag mit ihrem unterirdischen Rhizom (ein mehr oder weniger stark verdickt wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) das ganze Beet eingenommen. Schön blöd. Am Ende musste Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) von diesem Standort sicherheitshalber komplett weichen, als das Beet neu gestaltet wurde. Jedenfalls ist es nicht verwunderlich, dass sie sich in Deutschland inzwischen in ein paar Gegenden Naturstandorte erobert hat und ein eingebürgerter Neophyt ist. Ob es wohl stimmt, dass sich diese Aster nicht einmal vom Giersch (Aegopodium podagraria) verdrängen lässt? Ich kann es leider, aber auch glücklicherweise nicht überprüfen, weil Giersch eines der wenigen Unkräuter ist, das ich nicht habe.
Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) ist wieder mal so ein typischer Fall von Mitleidheischen im Pflanzenreich: Jahrelang haben wir sie gehätschelt und gepäppelt, denn sie wollte und wollte nicht wachsen. Dann ging alles ratzfatz, die Großblättrige Aster ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat mit einem Schlag mit ihrem unterirdischen Rhizom (ein mehr oder weniger stark verdickt wachsender Spross, der für das Breitenwachstum einer Rhizompflanze und dessen Stärke verantwortlich ist) das ganze Beet eingenommen. Schön blöd. Am Ende musste Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) von diesem Standort sicherheitshalber komplett weichen, als das Beet neu gestaltet wurde. Jedenfalls ist es nicht verwunderlich, dass sie sich in Deutschland inzwischen in ein paar Gegenden Naturstandorte erobert hat und ein eingebürgerter Neophyt ist. Ob es wohl stimmt, dass sich diese Aster nicht einmal vom Giersch (Aegopodium podagraria) verdrängen lässt? Ich kann es leider, aber auch glücklicherweise nicht überprüfen, weil Giersch eines der wenigen Unkräuter ist, das ich nicht habe.
 Schön an der Herzblättrigen Aster sind ihre hochsommerliche Blütezeit sowie die auffälligen rötlichen, leicht kantigen Stängel. Positiv an ihr ist auch, dass sie – zumindest in unserem schweren Lehmboden – nicht durch übermäßige Selbstaussaat unangenehm auffällt. Ihre Ausläufer lassen sich nämlich (wenn man's vorher weiß) mit einer Rhizom- bzw. Wurzelsperre (z. B. aus stabiler Teichfolie) im Zaum halten und deshalb braucht niemand auf sie zu verzichten.
Schön an der Herzblättrigen Aster sind ihre hochsommerliche Blütezeit sowie die auffälligen rötlichen, leicht kantigen Stängel. Positiv an ihr ist auch, dass sie – zumindest in unserem schweren Lehmboden – nicht durch übermäßige Selbstaussaat unangenehm auffällt. Ihre Ausläufer lassen sich nämlich (wenn man's vorher weiß) mit einer Rhizom- bzw. Wurzelsperre (z. B. aus stabiler Teichfolie) im Zaum halten und deshalb braucht niemand auf sie zu verzichten.
Weniger positiv ist, dass Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) nicht so furchtbar üppig blüht und zudem relativ kleine Einzelblüten hat. Gut ist sie daher in großen Gärten mit Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
aufgehoben. Oder aber in lichten Hecken und an Gehölzrändern, wo sie ihre Vorzüge voll und ganz ausspielen kann: Ihre Rosetten mit den großen, dunkelgrünen Blättern sind prima Bodendecker! An solchen Standorten wird ihr Breitenwachstum automatisch gebremst, denn es bleibt meistens nicht gar so viel Wasser für die Aster übrig, weil die Gehölze den Löwenanteil beanspruchen; solange es nicht zu trocken wird, hält Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) dem Wurzeldruck der Gehölze stand.
 Mit den passenden Stauden um sie herum kann eine Herzblättrige Aster natürlich auch im Beet ein richtiger Hingucker sein. Bei ihr kommt es allerdings weniger auf die direkte Nachbarschaft an als auf die Fernwirkung. Ein schönes Bild ergibt sich etwa mit der wuchtigen Riesen-Hänge-Segge (Carex pendula) im Hintergrund oder mit dem kompakten Berg-Reitgras (Calamagrostis varia). Nicht nur in Beetsituationen macht sich zudem der Wald-Geißbart (Aruncus dioicus) gut hinter, neben und mit der Herzblättrigen Aster, das ist auch eine schöne Kombination für nicht zu trockene Gehölzränder, beispielsweise Hecken.
Mit den passenden Stauden um sie herum kann eine Herzblättrige Aster natürlich auch im Beet ein richtiger Hingucker sein. Bei ihr kommt es allerdings weniger auf die direkte Nachbarschaft an als auf die Fernwirkung. Ein schönes Bild ergibt sich etwa mit der wuchtigen Riesen-Hänge-Segge (Carex pendula) im Hintergrund oder mit dem kompakten Berg-Reitgras (Calamagrostis varia). Nicht nur in Beetsituationen macht sich zudem der Wald-Geißbart (Aruncus dioicus) gut hinter, neben und mit der Herzblättrigen Aster, das ist auch eine schöne Kombination für nicht zu trockene Gehölzränder, beispielsweise Hecken.
Eurybia macrophylla – Großblättrige Aster, Herzblättrige Aster
| Wuchshöhe: | 35-100 cm |
| Blütenfarbe: | weiß bis violett (variabel) |
| Blütezeit: | August, September (Oktober) |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | eingebürgerter Neophyt |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
 Anspruchslos, was den Boden anbelangt, das ist eine Eigenschaft der Arktischen Aster, die immer wieder hervorgehoben wird. Dem kann ich zustimmen, möchte jedoch den Satz mit dem Hinweis ergänzen, dass das reine Gedeihen/
Anspruchslos, was den Boden anbelangt, das ist eine Eigenschaft der Arktischen Aster, die immer wieder hervorgehoben wird. Dem kann ich zustimmen, möchte jedoch den Satz mit dem Hinweis ergänzen, dass das reine Gedeihen/
In leichten Böden (sandig, kiesig, humos – das scheint sie zu bevorzugen) bildet Eurybia sibirica (Aster sibiricus) recht schnell einen dichten Teppich, während sie sich in schweren (Lehm-)Böden (damit arrangiert sie sich) – wie bei mir im Garten – nur langsam und weniger dicht ausbreitet. Als Bodendecker ist sie trotz dieser Einschränkung zu gebrauchen.

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) – Ausläufer
Die Empfehlung, Eurybia sibirica (Aster sibiricus) im Steingarten mit seinem durchlässigen, sandig-steinigen Substrat anzusiedeln, ist daher aus meiner Sicht etwas zu leichtfertig, denn dort muss man ihr Wuchsverhalten, ihre unterirdischen Ausläufer, stets im Blick behalten, damit empfindliche(re) Mitbewohner nicht bedrängt und gestört werden. Wenn Steingarten, dann also bloß größere bis große Steinanlagen, in denen der Polaraster ein ausreichend dimensionierter Pflanzplatz für ihre ungestörte Entwicklung zugestanden werden kann; eventuell am Fuß des Steingartens, vielleicht auf der Ost- oder Westseite, denn diese Aster verträgt Halbschatten gut (deshalb auch nur Morgen- oder Abendsonne).

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) Mitte August
Ein wenig unscheinbar ist die Sibirische Aster schon, selbst zur Blütezeit, weil sie halt "so weit unten" ist und kaum höher als 30 cm wird. Sie sollte daher stets eine "Randerscheinung" (Gehölzrand, Beetrand, Einzelstellung) sein, egal, wohin man sie pflanzt. Inmitten anderer – höherer – Stauden und Ziergräser ginge sie einfach unter, obwohl ihre Blütenköpfe verhältnismäßig (im Verhältnis zur Gesamtgröße) groß sind und die Blütenstiele mit ihrer (in der Regel und zumindest zum Teil) rötlichen Färbung ganz nett sind. Und wann blüht die Arktische Aster jetzt eigentlich? Die Hauptblütezeit ist definitiv im Juni. Sie erstreckt sich bis in den Juli, ein paar Nachzügler-Blüten hat man mitunter noch im August. Aber dann ist Schluss. Wie es zu Aussagen wie "August bis September" kommt, kann ich nur vermuten: Eventuell beginnt Eurybia sibirica an den Naturstandorten etwas später zu blühen (und blüht dafür etwas länger), weil so hoch im Norden ja das Frühjahr später beginnt und dadurch die Vegetationsphase nach hinten geschoben wird; diese Angaben hat man dann "blind" übernommen, anstatt sie in anderen Regionen erst einmal zu prüfen. Das wäre möglich, ist jedoch nicht sicher.

Eurybia sibirica (Sibirische Aster) – Austrieb
Sicher ist aber, dass die Polaraster am besten auf größeren Flächen wirkt, und wer kann, der sollte daher wenigstens einen halben Quadratmeter für sie reservieren. Auf so einer Fläche sollten Sie fünf Exemplare im Abstand von 30‑40 cm zueinander pflanzen. Das wird dann schon dicht. Meine Einzelstücke machen jedenfalls selbst nach vier Jahren noch nicht besonders viel her.
Ist die Polaraster überhaupt winterhart? Ja, in ihrem Fall halten die deutschen Namen Arktische oder Sibirische Aster und Polaraster, was sie versprechen. Wer so weit im Norden wohnt (u. a. Nord-Russland, Sibirien, Norwegen) wie Eurybia sibirica (Aster sibiricus), der kommt mit unseren mitteleuropäischen Wintern selbstverständlich problemlos zurecht, zumal wenn er sommergrün ist und im Herbst einzieht.
Eurybia sibirica – Sibirische Aster, Arktische Aster, Polaraster
| Wuchshöhe: | 10-30 cm |
| Blütenfarbe: | hell violett |
| Blütezeit: | (Mai) Juni, Juli (August) |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: |
Galatella – Steppenaster
(Pflanzenfamilie: Asteraceae – Korbblütler)
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
In der Gattung Galatella waren schon im 18. und 19. Jahrhundert Astern untergebracht, bevor man sie in der Gattung Aster zusammenfasste. Jetzt rudert man aufgrund molekularbiologischer und neuer morphologischer Untersuchungen zurück und hat einige Astern-Arten wieder zu Galatella gepackt.

Galatella linosyris (Goldhaaraster, Goldaster) mit Kleinem Feuerfalter
Heimat dieser Arten sind Europa und Asien; sie fallen äußerlich durch ihre dicht beblätterten Stängel sowie die ganz fein (Makroaufnahme, Lupe, Mikroskop!) behaarten Blätter und Stängel auf.
Sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale sitzen bei diesen Arten ausschließlich in den Röhrenblüten (Blütenscheibe). Kein Wunder, dass sich ein paar davon – wie Galatella linosyris, die Goldhaaraster – die Strahlenblüten gleich ganz sparen.
Galatella linosyris – Goldhaaraster, Goldaster, Steppenaster, Gold-Steppenaster, Goldschopf
alt: Aster linosyris
 Lässt sich ganz leicht aus Samen ziehen, die Goldhaaraster. Die feinen Samen werden in einem Töpfchen oder Kistchen mit unkrautfreier Erde mit Daumen und Zeigefinger möglichst gleichmäßig verteilt und nur hauchdünn mit Erde bedeckt. Bei ca. 20 °C und gleichbleibender Feuchtigkeit (nicht Nässe!) keimen sie recht rasch, vor allem wenn die Aussaatgefäße mit Folie oder einer Glasscheibe abgedeckt sind. Frisches Saatgut keimt zudem sehr zuverlässig.
Lässt sich ganz leicht aus Samen ziehen, die Goldhaaraster. Die feinen Samen werden in einem Töpfchen oder Kistchen mit unkrautfreier Erde mit Daumen und Zeigefinger möglichst gleichmäßig verteilt und nur hauchdünn mit Erde bedeckt. Bei ca. 20 °C und gleichbleibender Feuchtigkeit (nicht Nässe!) keimen sie recht rasch, vor allem wenn die Aussaatgefäße mit Folie oder einer Glasscheibe abgedeckt sind. Frisches Saatgut keimt zudem sehr zuverlässig.

Galatella linosyris (Goldhaaraster, Goldaster) – Samenstände
Und wohin dann mit den Pflanzen? Nun, bei Galatella linosyris (Aster linosyris) ist das recht simpel, die ist so anspruchslos, dass ihr nahezu jeder Standort recht ist. Die Betonung liegt auf nahezu! Am Naturstandort weist die Goldhaaraster auf (sehr) trockenen, (sehr) stickstoffarmen und kalkhaltigen Boden hin. Bevorzugt wird dazu volle Sonne bis leichter Schatten. Ähnliche Voraussetzungen sollten wir ihr auch im Garten bieten, dann können wir uns alle Pflege bis auf vielleicht mal ein Schlückchen Wasser sparen. Ein Rückschnitt der Triebe nach der Blüte ist nicht erforderlich (außer für die Optik), denn diese Aster neigt nicht zu Selbstaussaat und "überschwemmt" dadurch nicht den ganzen Garten mit ihren Nachkommen.

Galatella linosyris (Goldhaaraster, Goldaster) – Austrieb
In nährstoffreichen Böden gedeiht sie ebenfalls, dann geht es allerdings nicht ganz ohne Pflege, denn die Triebe sollten in dem Fall im Juni eingekürzt werden (etwa in der Höhe halbieren/
Die minimalistischen Blüten der Galatella linosyris
 Eine Besonderheit der (Gold-)
Eine Besonderheit der (Gold-)

Stift-Schwebfliege auf Galatella linosyris (Goldhaar-Aster, Gold-Aster)
Im Versuchsgarten hat es ein paar Jährchen gedauert, bis sich Galatella linosyris (Aster linosyris) etabliert hatte, wohl weil ihr selbst der ungedüngte Lehmboden in unserem Garten noch zu "fett" war; Lehmboden ist halt mal von Natur aus nährstoffreicher als zum Beispiel Sandboden. Oder zu schwer, das könnte auch sein. Jetzt jedenfalls erfreut uns diese einheimische Staude Jahr für Jahr mehr. Und nicht nur uns – Insekten wie Schwebfliegen, Schmetterlinge, Honigbienen und Wildbienen sind von der Goldhaar-Aster begeistert. Ihr Nektar scheint köstlich und gut erreichbar zu sein. Fünf Falter-Arten (Spanner und Eulenfalter) sind zudem mehr oder weniger auf Galatella linosyris (Aster linosyris) als Futterpflanze für die Raupen angewiesen. Und bei einer Wildbienen-Art wurde das Sammeln des Pollens für die Larven im Nest (nur die Weibchen betreiben Brutfürsorge) wissenschaftlich nachgewiesen: Colletes collaris (Goldaster-Seidenbiene). Diese Seidenbiene kommt in Deutschland allerdings nur im Schwarzwald (Kaiserstuhl und Tuniberg) vor.

Colletes similis sammelt an Galatella linosyris (Goldhaaraster, Goldaster)
Nicht wissenschaftlich belegt, dafür jedoch selbst bei mir im Garten beobachtet, ist das Pollensammeln der häufigeren und weit verbreiteten Colletes similis (Rainfarn-Seidenbiene) an Galatella linosyris. Darüber freue ich mich besonders. Dass bislang nicht festgestellt wurde, dass die Rainfarn-Seidenbiene ebenfalls an der Goldhaaraster Pollen sammelt, könnte unter anderem daran liegen, dass die Bestände dieser Astern-Art in der Natur stetig zurückgehen; die Bundesländer mit Naturstandorten schlagen bereits Alarm.
Da sieht man wieder mal, wie wichtig unsere Gärten für den Erhalt der Artenvielfalt sind – in jeder Hinsicht!
Näheres zur Lebensweise der Rainfarn-Seidenbiene lesen Sie bei Galatella sedifolia ('Nanus'). Mehr Informationen über Wildbienen allgemein erhalten Sie auf meiner Seite Wildbienen im Stauden-Garten.
Galatella linosyris – Goldhaaraster, Goldaster
| Wuchshöhe: | 50-110 cm |
| Blütenfarbe: | goldgelb |
| Blütezeit: | August, September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | Dachbegrünung |
| Hinweis: | kalkhaltiger Boden; Pollenlieferant für Wildbienen; bereits im Hortus Eystettensis erwähnt |
Galatella sedifolia 'Nanus' – Ödlandaster, Rhoneaster (Rhôneaster), Sedumblättrige Aster, Graublättrige Aster
alt: Aster sedifolius 'Nanus'
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Wie Aster linosyris wurde Aster sedifolius vor einer Weile in die Gattung Galatella umquartiert. So richtig durchgesetzt hat sich die neue Gattungsbezeichnung (wie bei anderen Astern-Arten ebenfalls) in Deutschland noch nicht. Warum auch? Ist ja erst gut 20 Jahre her und wer weiß, ob der Name bleibt! Aussitzen ist halt für viele in vielen Bereichen die beste Wahl.
Wer sich die deutschen Namen Zwerg-Wildaster und Wilde Zwergaster für die Sorte 'Nanus' ausgedacht hat, dem ist marketingtechnisch ein toller Coup gelungen: Niedlich, entzückend, charmant sind tatsächlich ein paar Attribute, mit denen man 'Nanus' beschreiben könnte.
 Das heißt, vorausgesetzt diese Aster hat den richtigen Standort, an dem sie mit 30‑40 cm Höhe niedrig bleibt. Steht sie am Pflanzplatz nur etwas zu gut im Futter und bekommt sie zudem ein bisschen mehr Wasser, kann man Zweifel am Sortennamen 'Nanus' bekommen, denn 60‑80 cm – wie für die Art (nicht die Sorten) angegeben – werden dann mit über 90 cm sogar noch übertroffen. Richtig aufgefallen ist mir das erst beim Überarbeiten meiner Astern-Seiten, als ich alle enthaltenen Informationen noch mal genau nachgeprüft habe:
Das heißt, vorausgesetzt diese Aster hat den richtigen Standort, an dem sie mit 30‑40 cm Höhe niedrig bleibt. Steht sie am Pflanzplatz nur etwas zu gut im Futter und bekommt sie zudem ein bisschen mehr Wasser, kann man Zweifel am Sortennamen 'Nanus' bekommen, denn 60‑80 cm – wie für die Art (nicht die Sorten) angegeben – werden dann mit über 90 cm sogar noch übertroffen. Richtig aufgefallen ist mir das erst beim Überarbeiten meiner Astern-Seiten, als ich alle enthaltenen Informationen noch mal genau nachgeprüft habe:
Wenn ich nicht wüsste, dass alle Galatella sedifolia 'Nanus' bei mir im Garten von ein und derselben Mutterpflanze (meiner einzigen damals) stammen und ich sie nicht selbst vermehrt hätte … Zwei Exemplare im Steingarten wachsen niedrig wie ein "echter" 'Nanus', mehrere Pflanzen in verschiedenen Staudenbeeten über den ganzen Garten verteilt wachsen hoch wie "normale" Ödlandastern. Ich lasse das jetzt mal so stehen.

Galatella sedifolius 'Nanus' (Ödlandaster, Rhoneaster) – Austrieb
Pflegemaßnahmen bei der Ödlandaster
Galatella sedifolia (Aster sedifolius) zeichnen ihr horstiger Wuchs ohne Ausläufer sowie ihre Trockenheitsverträglichkeit aus. Ein bodennaher Rückschnitt der vorjährigen Blütentriebe im Frühling genügt als Pflegemaßnahme vollauf, denn sie sät sich nicht aus. Vielleicht noch ein bisschen Dünger oder Kompost (ohne Unkrautsamen) bei dieser Gelegenheit, das aber bitte nur bei sehr magerem Boden, damit sie nicht "ins Kraut schießt" und schön buschig bleibt.

Beide am 19.09. fotografiert: G. sedifolia 'Nanus' (Ödlandaster, Rhoneaster) nach einem Rückschnitt …
Falls Sie bereits im Juni feststellen, dass die Triebe der Galatella sedifolia 'Nanus' (Aster sedifolius) auseinanderdriften, oder Sie auf Nummer sicher gehen wollen, kürzen Sie die Stängel etwa um die Hälfte. Die Triebe verzweigen sich beim Neuaustrieb stärker, der Horst wird kompakter und das Höhenwachstum gebremst. Allerdings verzögert so ein Zurückschneiden den Blühbeginn um etwa ein bis zwei Wochen. Das ist nicht unbedingt das Schlechteste, verlängert sich auf diese Weise doch auch das Nahrungsangebot für Insekten bis in den Herbst. Optimal und sinnvoll ist deshalb eine Mischung: Eine (oder mehrere) Rhoneaster lässt man ohne Rückschnitt wachsen, eine (oder mehrere) schneidet man im Juni (spätestens Anfang Juli) auf halbe Höhe zurück.

… und ohne einen solchen Juni-Rückschnitt
Durch die Blütezeit im Spätsommer (ohne Rückschnitt) kommt die Ödlandaster in Gesellschaft von zarten Gräsern und höheren Herbstblühern gut zur Geltung. Wir verwenden sie zudem gern als "Lückenfüller" und "Abstandshalter" zwischen höheren Stauden und Ziergräsern, besonders solchen, die nach der Blüte zurückgeschnitten werden (müssen). Diese dankbare, robuste und ausdauernde Staude hat trotz aller Irritationen das Prädikat "besonders empfehlenswert" verdient! Ganz besonders im Winter, wenn alles trüb, trist und grau
Galatella sedifolia und die Rainfarn-Seidenbiene

Galatella sedifolius 'Nanus' (Ödlandaster, Rhoneaster) im Winter
In Deutschland nicht einheimisch, nicht als Pollenquelle für Wildbienen im neuesten Buch von Paul Westrich erwähnt ("Die Wildbienen Deutschlands", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-8186-0123-2) und trotzdem für Wildbienen interessant: Wenn sonst alles passt (Pflanzenfamilie, Blütenform und ‑größe), ist man als Wildbiene halt nicht so und sammelt auch an solchen "fremden" Pflanzen.

Colletes similis sammelt Pollen von Galatella sedifolia 'Nanus' (Ödlandaster, Rhoneaster)
Bei mir im Garten sammelt nach eigener Beobachtung die Rainfarn-Seidenbiene (Colletes similis) den Pollen von Galatella sedifolia (aster sedifolius) für ihre Larven (nur die Weibchen kümmern sich um die Brut). Wie etliche Seidenbienen, ist Colletes similis auf Korbblütler (Asteraceae) spezialisiert und nimmt den Pollen für die Brut nur von Pflanzen aus dieser Familie (oligolektisch nennt man das im Fachjargon der Insektenkundler). Diesen Bienen kann man im Garten also neben Galatella sedifolia und Galatella linosyris zum Beispiel Alant-Arten (Inula), Schafgarbe (Achillea) oder Goldruten (Solidago) anbieten. Hier noch ein kleiner Steckbrief von Colletes similis:
Vorkommen: In Deutschland weit verbreitet und mäßig häufig – diese Bienen-Art mag es warm und trocken
Flugzeit: Fliegt mit einer Generation pro Jahr von Ende Juni bis Ende September
Nistplatz: Selbst gegrabene Gänge sowohl in Steilwänden als auch in ebenen bis schwach geneigten Böden ohne bzw. mit nur spärlichem Bewuchs
Mein Artikel Wildbienen im Stauden-Garten informiert Sie ausführlicher über dieses Thema.
Galatella sedifolia 'Nanus' – Ödlandaster, Rhoneaster (Rhôneaster), Sedumblättrige Aster, Graublättrige Aster
| Wuchshöhe: | 35-90 cm |
| Blütenfarbe: | zart lila |
| Blütezeit: | September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | Pollenlieferant für Wildbienen |
Symphyotrichum – Herbstaster
(Pflanzenfamilie: Asteraceae – Korbblütler)
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
Schön blöd, dass gerade die am weitesten in der Gartenkultur verbreiteten und züchterisch am meisten bearbeiteten Astern durch die Neuordnung der Gattung Aster in eine Gattung mit so unaussprechlichem (beim Schreiben wird's auch nicht besser) Namen katapultiert wurden: Symphyotrichum.
 Symphyotrichum laeve (Glatte Aster)
Symphyotrichum laeve (Glatte Aster)
Symphyotrichum ist eine Gattung mit sehr variablen Arten, die über ganz Amerika verstreut natürlich vorkommen; bislang eine Art ist in Eurasien beheimatet. Ihre genaue Bestimmung fällt oft sogar Experten schwer. So variabel wie die Arten im Habitus (zum Beispiel wenige Zentimeter bis über zwei Meter) und im Wuchsverhalten (mit und ohne Ausläufer) sind, so unterschiedlich sind ihre Standortansprüche.
Viele – darunter ausgerechnet die Beliebtesten – verbindet jedoch ihre Anfälligkeit für Mehltau, vor allem Symphyotrichum novi-belgii, dumosum und ericoides (alt: Aster novi-belgii, dumosus und ericoides). Pflanzenteile, die Sie entfernen (müssen), weil sie unter Mehltau leiden, dürfen nicht auf den Kompost; sie gehören in den Restmüll!
Weil es übersichtlicher ist, teile ich die Herbstastern in zwei Gruppen: die Wildarten, die kaum züchterisch bearbeitet werden, und die drei beliebtesten Herbstaster-Arten, die in der Gartenkultur nur in Sorten verwendet werden.
Wildarten, die nur selten in Sorten angeboten werden
Symphyotrichum ericoides – Myrthenaster, Erikaaster
alt: Aster ericoides
Die Myrtenaster ist die "späteste" Aster im Garten und blüht bis zum Frost. Ihre zarten, weiß-gelben Blüten dienen damit den Insekten als eine der letzten Nektarquellen vor dem Winter. Vom Habitus erinnert sie aus der Ferne an Schleierkraut und wie dieses ist sie als Schnittblume geeignet.
 Bei Symphyotrichum ericoides (Aster ericoides) ist es weniger die Selbstaussaat (mit der man ohne Rückschnitt nach der Blüte freilich rechnen muss), die uns auf Trab hält, es sind eher die Ausläufer. Man muss also jedes Jahr hinterher sein und die Wurzeln rigoros ausgraben, sonst wird aus einem halben Quadratmeter Symphyotrichum ericoides (Aster ericoides) ein ganzer und leicht auch mehr.
Bei Symphyotrichum ericoides (Aster ericoides) ist es weniger die Selbstaussaat (mit der man ohne Rückschnitt nach der Blüte freilich rechnen muss), die uns auf Trab hält, es sind eher die Ausläufer. Man muss also jedes Jahr hinterher sein und die Wurzeln rigoros ausgraben, sonst wird aus einem halben Quadratmeter Symphyotrichum ericoides (Aster ericoides) ein ganzer und leicht auch mehr.
 Die Myrten-Aster verträgt durchaus Schatten, braucht allerdings einen freien Stand. Unter Gehölzen bleibt sie klein, um nach ein paar Jahren meist ganz zu verschwinden, weil sie trotz ihres Ausbreitungsdranges den Wurzeldruck nicht verträgt. Zwischen Bäumen und Sträuchern sowie am Gehölzrand fühlt sie sich allerdings im lichten Schatten sehr wohl. Voraussetzung: Der Boden bietet genügend (Rest-)
Die Myrten-Aster verträgt durchaus Schatten, braucht allerdings einen freien Stand. Unter Gehölzen bleibt sie klein, um nach ein paar Jahren meist ganz zu verschwinden, weil sie trotz ihres Ausbreitungsdranges den Wurzeldruck nicht verträgt. Zwischen Bäumen und Sträuchern sowie am Gehölzrand fühlt sie sich allerdings im lichten Schatten sehr wohl. Voraussetzung: Der Boden bietet genügend (Rest-)
Ein Standort im Staudenbeet ist natürlich ebenfalls eine Option, dort sollte man jedoch besser mit einer Wurzelsperre aus stabiler Teichfolie oder Ähnlichem arbeiten, damit die Erikaaster umstehende Pflanzen nicht verdrängt. Wir haben mal einen größeren Bestand ausgegraben mit dem Ziel, ihn komplett zu entfernen, doch noch Jahre später tauchen neue kleine Triebe auf (und müssen ausgegraben werden).
 Ein Hingucker ist die Myrthen-Aster mit ihrer herbstlichen Blüte allemal. Sehr reizvoll wirkt sie in Kombination mit Fruchtschmuck anderer Blütenstauden wie dem von Liatris spicata (Ährige Prachtscharte), Rudbeckia occidentalis 'Green Wizard' (Westlicher Sonnenhut) oder Phlomis russeliana (Brandkraut) und natürlich höhere Ziergräser.
Ein Hingucker ist die Myrthen-Aster mit ihrer herbstlichen Blüte allemal. Sehr reizvoll wirkt sie in Kombination mit Fruchtschmuck anderer Blütenstauden wie dem von Liatris spicata (Ährige Prachtscharte), Rudbeckia occidentalis 'Green Wizard' (Westlicher Sonnenhut) oder Phlomis russeliana (Brandkraut) und natürlich höhere Ziergräser.
Die reine Art Symphyotrichum ericoides hat sich bei mir im Garten als sehr robust und relativ wenig krankheits- und schädlingsanfällig erwiesen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will oder andere Wuchshöhen und Blütenfarben sucht, kann auch auf Sorten zurückgreifen, die sich bei der Staudensichtung als besonders empfehlenswert gezeigt haben: 'Lovely', rosaviolett, 80‑90 cm; 'Pink Cloud', violettrosa, 90‑120 cm; 'Schneetanne', weiß, 120‑150 cm.
Symphyotrichum ericoides – Myrthenaster, Erikaaster
| Wuchshöhe: | 100-130 cm |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: |
Symphyotrichum ericoides var. prostratum 'Snow Flurry' – Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
alt: Aster ericoides var. prostratus
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
Diese Astern-Art hat mehr Namen als der Sprössling eines Adelshauses und alle sind in Verwendung: Symphyotrichum ericoides, Symphyotrichum var. prostrata, Symphyotrichum diffusus, Symphyotrichum pansus, Symphyotrichum ericoides f pansus – selbstverständlich alle noch in der Variante mit dem (ehemaligen) Gattungsnamen Aster, also Aster pansus, Aster diffusus etc.
 Ich habe mich mit dem Namen Symphyotrichum ericoides var. prostratum an die botanische Namensgebung gehalten, die die Gärtnerei "Beth Chatto's Plants and Gardens" bei Colchester/
Ich habe mich mit dem Namen Symphyotrichum ericoides var. prostratum an die botanische Namensgebung gehalten, die die Gärtnerei "Beth Chatto's Plants and Gardens" bei Colchester/

Symphyotrichum 'Snow Flurry' (Teppich-Myrthenaster) – dichter Austrieb
Ich kann diese Varietät nur empfehlen – mit einer kleinen Einschränkung: Die 'Snow Flurry' braucht Platz, viel Platz. Sie wuchert zwar nicht ungezügelt, aber sie bildet in bester Bodendeckermanier richtig große Horste, genauer gesagt, eine Ansammlung lauter einzelner, eigenständiger Horste um den ursprünglichen herum. Es hängt ein bisschen vom Boden ab – von der Nährstoffversorgung unter anderem –, wie stark der jährliche Breitenzuwachs ist, ob es kurze Ausläuferchen sind (was normal ist, um Horste zu bilden) oder längere Ausläufer und ob das Ganze als ein (großer) Horst oder mehrere (einzelne) Horste betrachtet werden muss/

Symphyotrichum 'Snow Flurry' (Teppich-Myrthenaster) – lockerer Austrieb
Weil es gerade so gut passt, will ich mal das Wuchsverhalten von Astern kurz beschreiben: Bei Astern ist jeder Trieb, der im Frühjahr erscheint, ein Blütentrieb und der stirbt nach der Blüte ab. Im nächsten Frühling bilden die Pflanzen neue (Blüten-)
Wie viele 'Snow Flurry' verträgt ein Garten?
 'Snow Flurry' blüht hübsch und überreich und wenn die Pflanzen eingewachsen sind, braucht man in recht trockenen Jahren nicht permanent mit der Gießkanne um sie herumzuschwänzeln, damit sie bloß nicht verdursten. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Erst im Frühling entfernen wir die abgeblühten, langen Triebe vom Vorjahr (immer ein paar der alten Triebe in die Hand nehmen, nachspüren, wo sie herkommen, und unten abschneiden). Das genügt völlig, denn diese Teppich-Myrthen-Aster sät sich nicht aus (die Keimfähigkeit der Samen ist gering), und man kann ihren späten Blütenflor auskosten bis zuletzt.
'Snow Flurry' blüht hübsch und überreich und wenn die Pflanzen eingewachsen sind, braucht man in recht trockenen Jahren nicht permanent mit der Gießkanne um sie herumzuschwänzeln, damit sie bloß nicht verdursten. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Erst im Frühling entfernen wir die abgeblühten, langen Triebe vom Vorjahr (immer ein paar der alten Triebe in die Hand nehmen, nachspüren, wo sie herkommen, und unten abschneiden). Das genügt völlig, denn diese Teppich-Myrthen-Aster sät sich nicht aus (die Keimfähigkeit der Samen ist gering), und man kann ihren späten Blütenflor auskosten bis zuletzt.
Ob sich der flache Bodendecker dank der Tugend des Nichtaussäens für Steingärten ebenfalls eignet, hängt von deren Größe ab; ich rate bei dieser vitalen Teppich-Aster von einem Platz im Steingarten grundsätzlich ab. Auch in Topfgärten ist sie mit Vorsicht zu genießen: Es sieht zwar hinreißend aus, wenn ihre langen Blütenranken über die Ränder von Kästen und Kübeln hängen, doch das geht nicht lange gut. Andererseits sind Topfgärtner ja daran gewöhnt, ihre Schützlinge regelmäßig auszubremsen, also warum nicht mal eine 'Snow Flurry' verwenden?
 Wer tatsächlich weitere Exemplare von 'Snow Flurry' benötigt, braucht nicht viel zu tun: Im März/
Wer tatsächlich weitere Exemplare von 'Snow Flurry' benötigt, braucht nicht viel zu tun: Im März/
Wenn wir schon beim Platz sind: Die besten Pflanzplätze (sonnig bis halbschattig) für die Teppich-Myrthen-Aster 'Snow Flurry' sind der Rand von Hecken (Gehölzen) und Stauden-Pflanzungen (ihre Ausbreitung im Blick behalten) sowie auf Mauerkronen und Flächen, mit denen man wenig zu tun (wenig Arbeit) haben will.
Jetzt noch ein Letztes: Immer wieder – speziell in Deutschland – wird von Gärtnereien der Sortenname als 'Snowflurry' angegeben. No, nein. Sortennamen werden weltweit so verwendet, wie sie ursprünglich eingeführt wurden. Und das ist in diesem Fall nun mal das Englische 'snow flurry' (Schneegestöber). Nur weil man im Deutschen Schneegestöber zusammenschreibt, wird daraus noch lange kein 'Snowflurry'. Und schon gar nicht der Sortenname 'Schneegestöber'.
Symphyotrichum ericoides var. prostratum 'Snow Flurry' – Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
| Wuchshöhe: | 5-25 cm |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | trocken-frisch |
| Verwendung: | Bodendecker |
| Hinweis: |
Symphyotrichum laeve – Glatte Aster, Kahle Aster
alt: Aster laevis
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
 Die Glatte Aster (ursprünglich aus Nordamerika) ist in Deutschland aus den Gärten ausgebüxt und treibt als eingebürgerter Neophyt gern in urbanen Gefilden in sehr stickstoffreichen Böden ihr Unwesen. Das verweist schon auf eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften: Sie sät sich reichlich aus, wenn man sie lässt und Verblühtes nicht rechtzeitig vor der Samenreife abschneidet. Und wo so ein Samenkorn hinfällt, da keimt es (meistens).
Die Glatte Aster (ursprünglich aus Nordamerika) ist in Deutschland aus den Gärten ausgebüxt und treibt als eingebürgerter Neophyt gern in urbanen Gefilden in sehr stickstoffreichen Böden ihr Unwesen. Das verweist schon auf eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften: Sie sät sich reichlich aus, wenn man sie lässt und Verblühtes nicht rechtzeitig vor der Samenreife abschneidet. Und wo so ein Samenkorn hinfällt, da keimt es (meistens).
In Wildstaudenpflanzung
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstauden-Pflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
und naturnahen Gärten
Naturnaher Garten:
Ein Garten, der weitgehend unter Verwendung von einheimischen
Pflanzen angelegt ist.
sind ihre Sämlinge sicher willkommen, und dort spielt es auch keine große Rolle, dass die neuen Pflänzchen vielleicht keine Symphyotrichum laeve (Aster laevis), sondern Kreuzungen mit dem sehr ähnlichen Symphyotrichum oolentangiense (Aster azureus) sind, sofern das ebenfalls im Garten steht; auch mit Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) kreuzt sie sich. Wir können die Zufallssämlinge im Versuchsgarten jedenfalls kaum mehr zuordnen, weil sie natürlich Merkmale von beiden Elternteilen zeigen.
 Was die Glatte Aster sonst noch so ausmacht: kurze Ausläufer (nicht schlimm), violettblaue Zungenblüten um gelbe Röhrenblüten und meist rötliche Stängel. Mit ihrem lockeren, breitbuschigen Wuchs setzt sie im Beet die schönsten Akzente, wenn an verschiedenen Stellen jeweils nur einzelne Exemplare gepflanzt werden.
Was die Glatte Aster sonst noch so ausmacht: kurze Ausläufer (nicht schlimm), violettblaue Zungenblüten um gelbe Röhrenblüten und meist rötliche Stängel. Mit ihrem lockeren, breitbuschigen Wuchs setzt sie im Beet die schönsten Akzente, wenn an verschiedenen Stellen jeweils nur einzelne Exemplare gepflanzt werden.
Neben Baptisia australis (Indigolupine, Blaue Färberhülse), die zur Blütezeit von Symphyotrichum laeve hauptsächlich wegen ihres Blattschmucks interessant ist, machen sich Anaphalis margaritacea (Großblütiges Perlkörbchen), hohe Fetthennen-Arten (Sedum spectabile und telephium) und Ziergräser wie Miscanthus-sinensis-Sorten (Silber-Chinaschilf), Calamagrostis varia (Berg-Reitgras) und Panicum virgatum (Echte Rutenhirse) gut als Begleiter von Symphyotrichum laeve (Aster laevis). Ganz ohne Nachbarn steht eine einzige Kahle Aster doch etwas verlassen in der Gegend rum.
Symphyotrichum laeve – Glatte Aster, Kahle Aster
| Wuchshöhe: | 90-145 cm |
| Blütenfarbe: | blauviolett |
| Blütezeit: | August, September (Oktober) |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | Schnittpflanze |
| Hinweis: | kalkhaltiger Boden; eingebürgerter Neophyt |
Symphyotrichum oolentangiense – Himmelblaue Aster
alt: Aster azureus
Aster Aster
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
Dass Aster azureus vor der Ausgliederung in die Gattung Symphyotrichum einen Wechsel der Artbezeichnung von azureus zu oolentangiense mitgemacht hat, ist an Deutschland weitgehend vorbeigegangen. Kommt vor.

Die Himmelblaue Aster aus dem Osten und Mittleren Westen Amerikas hält nicht ganz, was der deutsche Name verspricht: Unter "himmelblau" stelle ich mir nun mal kein helles Violett vor. Andere sehen das offenbar anders und machen aus ihrer Begeisterung keinen Hehl. Sie werfen als Verkaufsargument sogar die "Azurblaue Himmelblaue Aster" in den Ring …
Viele kleine hellviolette Einzelblüten stehen bei Symphyotrichum oolentangiense (Aster azureus) ab irgendwann im August auf recht dünnen Stielen. Mit gut einem Meter Höhe (auch mal bis 1,50 cm) sind die Stängel eigentlich zu hoch (und für die Höhe wiederum zu schwach), um die Blüten zu balancieren. Demzufolge lässt die Standfestigkeit der Himmelblauen Aster zu wünschen übrig: Wind, Regen und Trockenheit bringen sie schnell aus dem Gleichgewicht.

Dafür ist sie zäh, anspruchslos und wenig pflegeintensiv. Ein rechtzeitiger, gleich bodennaher Rückschnitt der Blütenstände nach dem Verblühen verhindert unkontrolliertes Aussäen, wo ihr Verwildern nicht erwünscht ist. Symphyotrichum oolentangiense (Aster azureus) und Symphyotrichum laeve (Aster laevis – Glatte Aster, Kahle Aster) im selben Garten oder wenigstens nicht weit voneinander entfernt, sorgen schon bald für eine "bunte" Mischung an Hybriden. – Diese beiden recht ähnlichen nordamerikanischen Astern-Arten kreuzen sich sehr gern miteinander. Wer das nicht möchte, sollte also ein wenig aufpassen und den richtigen Zeitpunkt (vor der Samenreife) für den Rückschnitt von Verblühtem bei beiden nicht verpassen.
Ihren ganzen Charme versprüht die Himmelblaue Aster in Ensembles mit Helenium autumnale (Gewöhnliche Sonnenbraut) oder Heliopsis helianthoides (Sonnenauge). Solche Arrangements vermitteln Leichtigkeit und machen gute (Sommer-)
Symphyotrichum oolentangiense – Himmelblaue Aster
| Wuchshöhe: | 70-145 cm |
| Blütenfarbe: | hellviolett |
| Blütezeit: | August, September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | frisch-mäßig trocken |
| Verwendung: | Schnittpflanze |
| Hinweis: |
Symphyotrichum dumosum bzw. Symphyotrichum-Dumosum-Hybriden – Kissenaster, Buschige Aster
alt: Aster dumosus bzw. Aster-Dumosus-Hybriden
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster
Jetzt kommt's: Wann gehört eine Sorte zu Symphyotrichum dumosum und ist eine Symphyotrichum-Dumosum-Hybride?

Bedingt durch die vielen züchterischen Kreuzungen von Symphyotrichum dumosum (Aster dumosus) mit Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) ist heute oft gar nicht mehr sicher, welcher Art die Hybride nun zugeordnet werden soll. Deshalb haben die Staudengärtner eine ganz simple Übereinkunft getroffen: Wenn die Pflanze, die bei der Kreuzung herauskommt, niedriger als 50 cm bleibt, wird sie Symphyotrichum dumosum (Aster dumosus) zugeordnet, andernfalls …
So kann eine Lösung natürlich auch aussehen. Bleibt zu hoffen, dass bei der Bestimmung stets alle Faktoren, die für die Wuchshöhe ausschlaggebend sind, berücksichtigt werden: optimale Wasserversorgung, maximale Düngergabe, ideale Temperaturen und der beste Boden, den es für Symphyotrichum dumosum (Aster dumosus) geben kann!
Was wir in unseren Gärten als Kissenaster kultivieren, hat mit dem eigentlichen und sehr "mageren" Symphyotrichum dumosum (Aster dumosus) demnach wenig zu tun. Es handelt sich dabei ausschließlich um Hybriden, die im Lauf der Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte aus Kreuzungen der Art Symphyotrichum dumosum mit Symphyotrichum novi-belgii hervorgegangen sind, also mit der Glattblattaster, der variabelsten unter den Herbstastern. Kein Wunder, dass die Symphyotrichum-Dumosum-Sorten ebenfalls farb- und formenreich daherkommen: rosa bis karminrot, fliederfarben bis violettblau sowie weiß, höher oder niedriger, selten allerdings höher als 50 cm ;-) .

Schön sehen die "aufgeplusterten" Blütenschirme in kleinen Tuffs von höchstens drei Pflanzen im Staudenbeet aus, gern werden die Sorten von Symphyotrichum dumosum zudem als niedrige bis halbhohe Einfassungspflanzen vor dem Hintergrund höherer Schmuckstauden verwendet. Dass ihre Wurzeln kurze Ausläufer treiben, kann man sich an problematischen Stellen zunutze machen und sie zur Hangbefestigung einsetzen.
Wie die Kissenaster auch gepflanzt wird, man sollte immer bedenken, dass sie anfällig für Mehltau ist (Echten und Falschen), was dichtes Pflanzen (nicht nur eng zusammen ist gemeint, sondern auch viele Pflanzen zusammen) noch fördert. Dieses Problem hat man mit dem Elternteil Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) ebenso – es wird halt nicht nur Gutes vererbt, nicht einmal bei Pflanzen. Stark mit Mehltau befallene Pflanzenteile sollten übrigens abgeschnitten und im Restmüll entsorgt werden; bloß nicht auf den Kompost werfen!

Symphyotrichum-Dumosum-Hybride (Kissen-Aster) – Austrieb
Eine schöne Kissenaster braucht etwas Pflege: Schneiden Sie die Blütentriebe vom Vorjahr im Frühling bodennah ab und bereiten Sie ihr mit Volldünger oder gut abgelagertem, unkrautsamenfreiem Kompost einen guten Start in die neue Vegetationsperiode. Weitere Düngergaben bis zur Blüte sind empfehlenswert, aber bitte mit Augenmaß (den Boden nicht überdüngen). Sie merken es: Die Symphyotrichum-Dumosum-Hybriden wollen nährstoffreiche Böden, gern etwas lehmig, und nicht zu trocken. Der Standort für sie liegt idealerweise vollsonnig bis leicht beschattet (Letzteres hauptsächlich um die Mittagszeit und in den frühen Nachmittagsstunden).

Viele Symphyotrichum-Dumosum-Sorten sind steril, von ihnen ist keine Selbstaussaat zu befürchten. Deshalb ist es auch nicht erforderlich (möglich ist es schon), deren verblühte Blütentriebe bereits im Spätherbst abzuschneiden. Dass die Stauden nach einigen Standjahren von innen verkahlen und nicht mehr ansprechend aussehen, habe ich in unserem Garten noch nicht erlebt. Teilen und vermehren kann man die Horste natürlich trotzdem, vorzugsweise im Frühjahr kurz vor oder beim Austrieb. Alternativ erfolgt die Vermehrung – ebenfalls im Frühling – mit Kopfstecklingen (Blätter im unteren Stecklingsdrittel entfernen), die in kleine Töpfchen mit Erde gesteckt und bei etwa 20 °C gleichmäßig feucht (nicht nass!) gehalten werden. Abdecken mit einer transparenten Plastikhaube erhöht die Luftfeuchtigkeit, wenn die Stecklinge nicht in einem Gewächshaus untergebracht sind.
Symphyotrichum dumosum bzw. Symphyotrichum-Dumosum-Hybriden – Kissenaster, Buschige Aster
| Wuchshöhe: | 20-50 cm |
| Blütenfarbe: | Violett- und Rosatöne, weiß |
| Blütezeit: | September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | unbeständiger Neophyt |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Symphyotrichum novae-angliae (Raublattaster, Neuenglandaster) mit Sedum spectabile 'Matrona' (Schöne Fetthenne)
So schön sie auch ist, die Raublattaster, sie hat doch einen großen Nachteil, den ich nicht verheimlichen will: Die Blätter sterben früh (häufig schon vor der Blüte) ab, das heißt, die Triebe verkahlen von unten nach oben. Im Versuchsgarten begegnen wir diesem Phänomen (es handelt sich nämlich nicht um eine Krankheit), indem wir der Raublattaster Stauden zur Seite stellen, die ihren "Haarausfall" kaschieren. Das funktioniert prima mit einem hohen Fettblatt (Sedum spectabile oder telephium), aber Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Symphyotrichum novae-angliae (Aster novae-angliae) ist eigentlich in Kanada und Nordamerika zu Hause, hat sich aber quer über unsere Bundesrepublik an nicht wenigen Stellen als Neophyt einquartiert. Vielerorts ist es in Städten außerhalb von Gärten anzutreffen, das dürfte mit ihrem hohen Nährstoffbedarf (explizit Stickstoff) zusammenhängen.

Symphyotrichum novae-angliae (Raublattaster, Neuenglandaster) – Austrieb
Was den Standort ganz allgemein anbelangt, ist für die Raublattaster in erster Linie eine reichliche Wasserversorgung wichtig, sie toleriert sogar gelegentliche Überschwemmungen. Sonnig bis halbschattig sollte der Platz für sie sein und er darf gern geschützt liegen (die Wärme speichern).
Mitunter wird an Symphyotrichum novae-angliae (Aster novae-angliae) bekrittelt, dass seine Blüten nur bei schönem Wetter und tagsüber öffnen. Da halte ich dagegen, dass seine positiven Eigenschaften das mehr als wettmachen: Es ist sehr ausdauernd, wunderbar standfest, wächst horstig (ohne Ausläufer) und ist wenig anfällig für Krankheiten wie Mehltau. Was will man mehr? Lassen wir es doch abends schlafen gehen und tagsüber bei bedecktem Himmel dösen. Letzteres täten wir schließlich selbst manchmal gern.

Symphyotrichum novae-angliae (Raublatt-Aster) mit Männchen der Gelbbindigen Furchenbiene
In den meisten Fällen wird man in Gärten auf Sorten von Symphyotrichum novae-angliae (Aster novae-angliae) treffen. Achtung: Die Raublattaster sät sich aus, fällt jedoch meist nicht sortenecht. Um "seine" Sorte zu behalten, ist es daher ratsam, Triebe mit Verblühtem zeitnah abzuschneiden. Dramatisch ist das mit der Selbstaussaat nicht, es wird nicht der ganze Garten mit ihren Sämlingen überschwemmt. Vorzeitig zur Schere sollte schon allein deshalb nicht gegriffen werden, weil die Herbstastern eine wichtige Nektarquelle sind und damit ein wertvoller Baustein im ökologischen Gefüge; viel blüht ja oft nicht mehr um diese Jahreszeit.

Stimmungsvoller Spätsommer-Reigen: Galatella sedifolia 'Nanus' (Ödlandaster) vor Symphyotrichum novae-angliae (Raublattaster)
Raublattastern und Wildbienen
Zwei Wildbienen-Arten sind nicht nur für diese Nektar-Versorgung dankbar, sie "ernten" auch den Pollen als Proviant für ihre Larven in den Nestern, haben Wissenschaftler nachgewiesen: Heriades truncorum, die Gewöhnliche Löcherbiene (Flugzeit von Mitte Juni bis Mitte September), und Megachile centuncularis, die Kleine Garten-Blattschneiderbiene (Flugzeit der 1. Generation ab Anfang Juni, manchmal eine 2. Generation ab Mitte August). Diese beiden Bienen-Arten sind noch relativ häufig in Deutschland und weit verbreitet. Sie scheuen Wohngegenden nicht (das ist ihr Vorteil) und sind daher in und bei Gärten anzutreffen. Ihnen kommt das "Auswildern" von Symphyotrichum novae-angliae in die Natur zudem zugute.
Beide Wildbienen-Arten nehmen Nisthilfen in Form von Bambus- oder Schilfröhrchen an (3‑3,5 mm Innendurchmesser für die Löcherbiene, 6 mm für die Blattschneiderbiene), denn sie nisten in vorgefundenen Hohlräumen. Angeschnittene Pflanzenstängel, zum Beispiel Brombeer-Ruten und für die Blattschneiderbiene auch vorjährige Verbascum-Stängel (Königskerzen) sowie Totholz mit (Käfer-)

Weibchen von Megachile centuncularis, hier auf Baptisia australis (Indigolupine)
Heriades truncorum sammelt den Pollen ausschließlich an Korbblütlern (Asteraceae). Für sie sind als Pollenquellen zum Beispiel auch Alant-Arten (Inula), Schafgarben (Achillea millefolium und filipendulina) und Flockenblumen (Centaurea) attraktiv. Megachile centuncularis hingegen sammelt an Pflanzen aus vier verschiedenen Familien: Korbblütler (Asteraceae), Kardengewächse (Dipsacaceae), Schmetterlingsblütler (Fabaceae) und Johanniskrautgewächse (Hypericaceae). Pflanzen Sie für diese Blattschneiderbiene neben der Raublatt-Aster vielleicht noch Flockenblumen (Centaurea), Skabiosen (Scabiosa), Lupinen (Lupinus polyphyllus) oder Indigolupinen (Baptisia australis) und Echtes Johanniskraut/
Wer tiefere Einblicke in die Lebensweise der Wildbienen bekommen möchte, für den habe ich den Artikel Wildbienen im Stauden-Garten geschrieben. Viel Spaß bei der Lektüre!
Quellen:
- Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A., Neumeyer, R., (2004), Fauna Helvetica 9, Apidae 4, Neuchâtel (Schweiz), Centre de cartographie de la Faune
- Falk, S., Field Giude to the Bees of Great Britain and Ireland, Bloomsbury Wildlife Guides, 2017, ISBN 978-1-9103-8903-4 (PB)
- Westrich, P., Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer-Verlag Stuttgart, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8186-0123-2
Symphyotrichum novae-angliae – Raublattaster, Neuenglandaster
| Wuchshöhe: | 80-160 cm, je nach Sorte sehr unterschiedlich |
| Blütenfarbe: | (Blau-)Violett- und Rosatöne, weiß |
| Blütezeit: | August, September, Oktober – je nach Sorte sehr unterschiedlich |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | eingebürgerter Neophyt; Pollenquelle für Wildbienen |
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

Wo sie volle Sonne bekommt und stets genügend Feuchtigkeit hat, steht die Glattblattaster richtig. Es schadet ihr auch nicht, wenn sie gelegentlich "nasse Füße" hat, weil der Boden kurzzeitig überschwemmt ist. Richtig übel nimmt sie hingegen andauernde (sommerliche) Trockenheit, die sie noch anfälliger für Mehltaubefall macht als ohnehin (ich habe meine inzwischen deshalb eliminiert – war eine empfindliche, alte Sorte).
Aber ein frischer, möglichst gleichbleibend feuchter Boden ist nur die halbe Miete. Zu enger Stand der Pflanzen, ein Standort, an dem sich die Wärme staut, sowie zu wenig Nährstoffe leisten einem Befall mit Mehltau ebenfalls Vorschub. Davon haben sich die Gartler noch nie abschrecken lassen und deshalb ist die Neubelgienaster (und Hybriden) aus Nordamerika mittlerweile in Deutschland ein eingebürgerter Neophyt, der auf nährstoffreichen/
Der Punkt Wasserversorgung ist bei Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) ein wenig knifflig: Einerseits braucht es reichlich Feuchtigkeit für einen gesunden Wuchs (vielleicht sogar ohne Mehltau) und eine üppige Blüte, andererseits breitet es sich mit seinen kurzen Ausläufern umso massiver aus, je optimaler der Boden für diese Pflanzen ist. Damit kann es nicht nur in kleinen Gärten durchaus zur Plage werden. Ein etwas trockenerer Stand bremst es aus, man riskiert damit jedoch früheren und stärkeren Mehltaubefall. Es ist schon ein Kreuz!

Wie sehr Mehltau zuschlagen kann, hängt nicht minder von der Nährstoffversorgung des Standorts ab: Großzügiges Düngen – und Dünger/
Mein Tipp: Mit einer großen Schaufel abgelagertem Kompost, der im Frühjahr auf dem Wurzelstock verteilt wird, machen Sie nicht viel verkehrt. Ob die alten Blütentriebe erst bei dieser Gelegenheit bodennah abgeschnitten werden oder bereits im Herbst, um Selbstaussaat zu verhindern, hängt von der Gartensituation und Ihrem gestalterischen Empfinden ab.
Nach einigen Standjahren können die Horste der Glattblattastern überaltern. Im Extremfall beginnen sie dann bereits, in der Mitte zu verkahlen. Dann ist die richtige Zeit, den Wurzelstock im Frühling auszugraben, mit einem stabilen Messer oder dem Spaten in kleinere Stücke zu zerteilen und die Teilstücke andernorts neu einzupflanzen. Kräftiges Gießen dieser Jungpflanzen ist in den ersten Wochen nach dem Auspflanzen obligatorisch.
Wer seinen Garten mit Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) bereichern möchte – trotz aller Widrigkeiten und Pflegearbeiten ist es nämlich durchaus eine Bereicherung – wird zu Sorten greifen; die reine Art ist ja praktisch nicht im Handel. Von blau über violett nach rosa und rot sowie weiß blühende Typen stehen zur Verfügung. Ein weiteres Kriterium für die Wahl einer Sorte wird sicher die Resistenz gegenüber Mehltau und anderen Krankheiten sein und da sind die Folgenden bei der Staudensichtung angenehm aufgefallen:
'Blütenmeer', hellviolett, 50‑60 cm; 'Dauerblau', lila, 120‑140 cm; 'Jugendstil', violettrosa, 110‑130 cm; 'Karminkuppel', purpurrosa, 90‑110 cm (die am besten bewertete Sorte); 'Porzellan', porzellanblau, 70‑100 cm; 'Rosa Perle', rosa(‑violett), 90‑110 cm; 'Rosenhügel', hell purpurrosa, 80‑110 cm; 'Rosenpompon', violettrosa, 80‑90 cm; 'Rosenquarz', silbrigrosa, 90‑110 cm.
Hier gelangen Sie zu den gesamten Sichtungsergebnissen.
Symphyotrichum novi-belgii ist übrigens die Aster, die bei den Symphyotrichum-Dumosum-Hybriden (Kissenaster) für das große Chaos sorgt: Keiner weiß nach einer Kreuzung der beiden mehr so recht, welcher Art das "Kind" denn nun zugeordnet werden soll.
Symphyotrichum novi-belgii – Glattblattaster, Neubelgienaster
| Wuchshöhe: | 100-150 cm |
| Blütenfarbe: | (Blau-)Violett- und Rosatöne, weiß |
| Blütezeit: | September, Oktober |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | eingebürgerter Neophyt |
Zum Seitenanfang
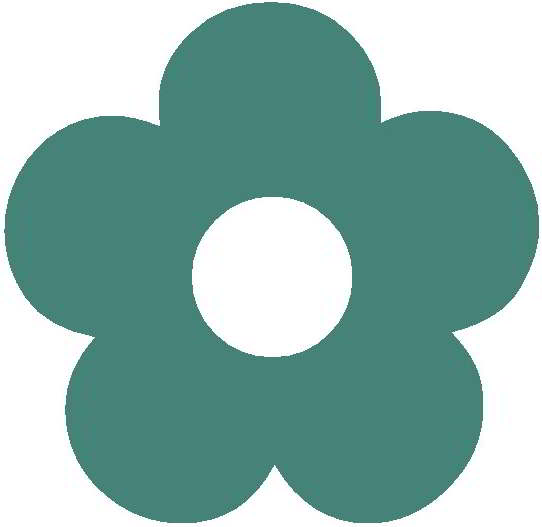
Weitere Staudengattungen
Achillea (Schafgarbe)
Acinos (Steinquendel)
Aconitum (Eisenhut)
Aconogonon (Bergknöterich)
Agastache (Duftnessel)
Ajuga (Günsel)
Alcea (Stockrose)
Alchemilla (Frauenmantel)
Althaea (Eibisch)
Alyssum (Steinkraut)
Amsonia (Blausternbusch)
Anaphalis (Perlkörbchen)
Androsace (Mannsschild)
Anemone (Anemone)
Antennaria (Katzenpfötchen)
Anthericum (Graslilie)
Aquilegia (Akelei)
Arabis (Gänsekresse)
Aralia (Aralie)
Arenaria (Sandkraut)
Armeria (Grasnelke)
Artemisia (Silberraute)
Aruncus (Geißbart)
Asphodeline (Junkerlilie)
Aster (Aster)
Astrantia (Sterndolde)
Aurinia (Steinkresse)
Baptisia (Indigolupine)
Bergenia (Bergenie)
Brunnera (Kaukasusvergissmeinnicht)
Buglossoides (Steinsame)
Calamintha (Bergminze)
Campanula (Glockenblume)
Centaurea (Flockenblume)
Cephalaria (Schuppenkopf)
Chamaemelum (Römische Kamille)
Chrysanthemum (Chrysantheme)
Clematis (Waldrebe)
Clinopodium (Bergminze)
Coreopsis (Mädchenauge)
Cymbalaria (Zimbelkraut)
Datisca (Scheinhanf)
Delphinium (Rittersporn)
Dianthus (Nelke)
Dictamnus (Diptam)
Digitalis (Fingerhut)
Dracocephalum (Drachenkopf)
Dryas (Silberwurz)
Echinacea (Scheinsonnenhut)
Echinops (Kugeldistel)
Echium (Natternkopf)
Epilobium (Weidenröschen)
Eryngium (Edeldistel, Mannstreu)
Euphorbia (Wolfsmilch)
Eurybia (Aster)
Filipendula (Mädesüß)
Gaillardia (Kokardenblume)
Galatella (Aster)
Gaura (Prachtkerze)
Gentiana (Enzian)
Geranium (Storchschnabel)
Geum (Nelkenwurz)
Gillenia (Dreiblattspiere)
Gypsophila (Schleierkraut)
Helenium (Sonnenbraut)
Helianthemum (Sonnenröschen)
Helianthus (Sonnenblume)
Heliopsis (Sonnenauge)
Helleborus (Christrose, Nieswurz)
Hemerocallis (Taglilie)
Herniaria (Bruchkraut)
Heuchera (Purpurglöckchen)
Hosta (Funkie)
Hypericum (Johanniskraut)
Hyssopus (Ysop)
Iberis (Schleifenblume)
Jasione (Sandglöckchen)
Kalimeris (Schönaster)
Knautia (Witwenblume)
Kniphofia (Fackellilie)
Lamium (Goldnessel)
Lavandula (Lavendel)
Leonurus (Herzgespann)
Leucanthemum (Garten-Margerite)
Liatris (Prachtscharte)
Ligularia (Goldkolben)
Limonium (Strandflieder, Meerlavendel)
Linaria (Leinkraut)
Linum (Lein)
Lithospermum (Steinsame)
Lupinus (Lupine)
Lychnis (Lichtnelke)
Lysimachia (Felberich)
Lythrum (Weiderich)
Malva (Malve)
Melissa (Melisse)
Mentha (Minze)
Monarda (Indianernessel)
Nepeta (Katzenminze)
Oenothera (Nachtkerze)
Oligoneuron (Aster)
Origanum (Dost, Oregano, Majoran)
Paeonia (Pfingstrose)
Papaver (Mohn)
Penstemon (Bartfaden)
Petrorhagia (Felsennelke)
Phlomis (Brandkraut)
Phlox (Flammenblume)
Platycodon (Ballonblume)
Polemonium (Jakobsleiter)
Polygonatum (Salomonssiegel)
Potentilla (Fingerkraut)
Primula (Aurikel, Schlüsselblume, Primel)
Prunella (Braunelle)
Pseudofumaria (Lerchensporn)
Pulmonaria (Lungenkraut)
Pulsatilla (Kuh-/Küchenschelle)
Rudbeckia (Sonnenhut)
Ruta (Raute)
Salvia (Salbei)
Sanguisorba (Wiesenknopf)
Saponaria (Seifenkraut)
Satureja (Bohnenkraut)
Saxifraga (Steinbrech)
Scabiosa (Skabiose)
Sedum (Fetthenne)
Sempervivum (Hauswurz)
Sideritis (Bergtee)
Silene (Leimkraut)
Solidago (Goldrute)
Stachys (Ziest)
Symphyotrichum (Aster)
Symphytum (Beinwell)
Tanacetum (Bunte Margerite)
Teucrium (Gamander)
Thalictrum (Wiesenraute)
Thymus (Thymian)
Tiarella (Schaumblüte)
Tradescantia (Dreimasterblume)
Trifolium (Klee)
Trollius (Trollblume)
Verbascum (Königskerze)
Verbena (Verbene)
Vernonia (Scheinaster)
Veronica (Ehrenpreis)
Veronicastrum (Arzneiehrenpreis)
Vinca (Immergrün)
Viola (Veilchen)
Waldsteinia (Waldsteinie)
Yucca (Palmlilie)
- Aster alpinus Alpen-Aster
- Aster amellus Berg- oder Kalk-Aster
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster
Eurybia Großblattaster
- Eurybia divaricata Weiße Waldaster
- Eurybia macrophylla Großblättrige Aster
- Eurybia sibirica Sibirische Aster
Galatella Steppenaster
- Galatella linosyris Goldhaaraster
- Galatella sedifolia 'Nanus' Ödlandaster
Symphyotrichum Herbstaster
Wildarten
- Symphyotrichum ericoides Myrthenaster, Erikaaster
- Symphyotrichum ericoides var. prostratum Teppich-Myrthenaster, Garten-Teppichaster
- Symphyotrichum laeve Glatte Aster, Kahle Aster
- Symphyotrichum oolentangiense Himmelblaue Aster
- Symphyotrichum dumosum Kissenaster, Buschige Aster
- Symphyotrichum novae-angliae Raublattaster, Neuenglandaster
- Symphyotrichum novi-belgii Glattblattaster, Neubelgienaster

 größeres Bild
größeres Bild















