Epilobium angustifolium – Wald-Weidenröschen, Schmalblättriges Weidenröschen
(Pflanzenfamilie: Onagraceae – Nachtkerzengewächse)

Die Raupe des Mittleren Weinschwärmers
In einem Garten, in dem jede Pflanze ihren festen Platz hat, den sie tunlichst nicht verlassen sollte, und in dem ungebetenen Sämlingen keinerlei Überlebenschance eingeräumt wird, ist das Schmalblättrige Weidenröschen sicher nicht anzutreffen. Sehr zum Bedauern etlicher Falter wie Spanner, Eulen und Schwärmer – darunter Mittlerer Weinschwärmer, Nachtkerzenschwärmer und Labkrautschwärmer –, deren Raupen es als Futterpflanze dient. Die meisten dieser Falter gehören zu denjenigen, die man eh so gut wie nie zu Gesicht bekommt, weil sie nachts fliegen. Falls doch, kann man sie nicht mal annähernd bestimmen, so unscheinbar und einander ähnlich sind sie. Es fällt also nicht auf, wenn sie fehlen.
In manche Gärten schafft es Epilobium angustifolium aber schon. Das sind diejenigen, in denen Wildstaudenpflanzungen
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstaudenpflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
dominieren oder die Gartenbesitzer zumindest teilweise die Anwesenheit von Pflanzen tolerieren, die mit sogenannten Prachtstauden wie etwa Rittersporn (Delphinium) wenig gemeinsam haben.
 Mit seinen vielen Vorzügen könnte es dem Wald-Weidenröschen im Lauf der Zeit vielleicht doch noch gelingen, mehr Menschen von sich zu überzeugen: Es blüht den ganzen Sommer über und das intensive Rosa bis Rosarot seiner Blüten ist von enormer Leuchtkraft mit einer grandiosen Fernwirkung. In nicht zu trockenen (gut, da kann man ein bisschen nachhelfen) und nicht zu heißen Sommern zeigen sich die kerzenförmigen Blütenstände, die von unten nach oben immer weiterwachsen und neue Blüten bilden, am längsten. Wie die Gaura lindheimeri (Prachtkerze) oder das Teucrium hyrcanicum (Kaukasus-Gamander) zum Beispiel, bildet auch das Epilobium angustifolium dadurch bereits während der Blüte die ersten Samen aus. Soll Selbstaussaat komplett verhindert und nicht nur eingedämmt werden, bleibt deshalb nichts anderes übrig, als jede verblühte Blüte (oder spätestens die Samenansätze) immer gleich zu entfernen. Ein mühsames Geschäft, das macht keiner, glaub ich.
Mit seinen vielen Vorzügen könnte es dem Wald-Weidenröschen im Lauf der Zeit vielleicht doch noch gelingen, mehr Menschen von sich zu überzeugen: Es blüht den ganzen Sommer über und das intensive Rosa bis Rosarot seiner Blüten ist von enormer Leuchtkraft mit einer grandiosen Fernwirkung. In nicht zu trockenen (gut, da kann man ein bisschen nachhelfen) und nicht zu heißen Sommern zeigen sich die kerzenförmigen Blütenstände, die von unten nach oben immer weiterwachsen und neue Blüten bilden, am längsten. Wie die Gaura lindheimeri (Prachtkerze) oder das Teucrium hyrcanicum (Kaukasus-Gamander) zum Beispiel, bildet auch das Epilobium angustifolium dadurch bereits während der Blüte die ersten Samen aus. Soll Selbstaussaat komplett verhindert und nicht nur eingedämmt werden, bleibt deshalb nichts anderes übrig, als jede verblühte Blüte (oder spätestens die Samenansätze) immer gleich zu entfernen. Ein mühsames Geschäft, das macht keiner, glaub ich.
Ein wichtiger Aspekt und Anreiz für neugierige Gärtner könnte die Verwendungsmöglichkeit des Schmalblättrigen Weidenröschens in der Küche sein, denn die Pflanzen sind essbar: Aus den jungen Trieben soll sich ein Gemüse zaubern lassen (wie Spargel?) und auch die Zubereitung von Epilobium angustifolium als Tee ist bekannt; Erfahrungen haben wir damit nicht. Seine Bedeutung als Heilpflanze ist unbedeutend, zumindest aber umstritten.
Standortvoraussetzungen für das Wald-Weidenröschen
Als Ruderalpflanze (Erstbesiedler) gibt sich Epilobium angustifolium selbst mit ungünstigen Bodenverhältnissen (gestörte Böden) zufrieden, als da wären humusarmer Lehmboden und übermäßiges Stickstoffangebot. Ein Nachteil sind humose Böden freilich nicht, solange sie nährstoffreich sind. Oder andersrum: Nährstoffarme Sandböden sagen diesem Weidenröschen nicht so zu. Was ihm jedoch zusagt, das sind kalkarme Böden (Mäßigsäurezeiger).

Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen), Jungpflanze
In der Natur (es handelt sich um eine in Deutschland – in ganz Europa – einheimische Pflanze, nicht gefährdet – in keinem Bundesland –, nicht besonders geschützt; Stand Februar 2025) taucht es bevorzugt auf Waldlichtungen und abgeholzten Waldflächen nach einem Kahlschlag auf. Drei Faktoren bestimmen damit die Lebensdauer von Epilobium angustifolium: die Nährstoffe, die Wasserversorgung und die Lichtintensität. Alle drei Faktoren sollten reichlich vorhanden sein (beim Licht genügt auch Halbschatten), und fällt einer oder fallen mehrere davon weg, verschwindet es. Die vielen Windbrüche und Sturmschäden in unseren Wäldern in den vergangenen Jahren dürften ganz nach dem Geschmack von Epilobium angustifolium sein. Wo es Verlierer gibt, gibt es halt immer auch Gewinner.
Ein Tiefwurzler wie das Schmalblättrige Weidenröschen kommt mit Trockenheit ganz gut zurecht, es fühlt sich jedoch an frischen Standorten wohler. Sollte es also nötig sein zu gießen, dann bitte besonders gründlich, damit das Wasser die tieferen Bodenschichten und damit die Wurzeln erreicht. Und damit "der Boden keinen Schnupfen kriegt", wie es der Stauden-Altmeister Karl Foerster so schön formuliert hat. Oberflächliches Wässern fördert nur die Bildung von seitlichen Wurzelsprossen, mit denen sich Epilobium angustifolium dann umso besser und mehr ausbreitet, allerdings auch dichter, üppiger und schöner wirkt. Ein ideales Einsatzgebiet für solches Wurzelwerk sind unbefestigte Hänge, an ihnen verhindert es, dass das Erdreich abrutscht.

Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen) – Samenstände
Die Ausläufer dieses Weidenröschens machen zwar vor nichts halt, sind allerdings wenig davon angetan, mit dem Rasenmäher rasiert zu werden. Es sollte deshalb kein Problem darstellen, sie vom dauerhaften Einwandern in Grasflächen abzuhalten. Großflächige Bestände können auf diese Weise ebenfalls reguliert werden.
Dass es Epilobium angustifolium zu Sorten gebracht hat, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für den Garten – gerade kleinere Gärten, in denen es auf jeden Quadratzentimeter ankommt – nicht ungefährlich ist mit seinem Ausbreitungs- und Vermehrungsdrang. Die Sorten gehen mit Samen und Ausläufern ebenso auf Tour wie die Art. Nur dass man bei der Selbstaussaat von Sorten nie sicher sein kann, was letztlich dabei rauskommt.
Epilobium angustifolium und seine Pflanzpartner

Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen) vor verblühten Campanula latifolia (Wald-Glockenblume)
Einen Nachteil von Epiloium angustifolium habe ich bereits erwähnt – den Ausbreitungsdrang. Den kann man im Griff behalten und sogar weitgehend unterbinden, indem diesem Weidenröschen durchsetzungsstarke Nachbarn zur Seite gestellt werden, denen es ihrerseits nicht schadet, ein bisschen Konkurrenz zu bekommen. Alcea rugosa oder rosea (Stockrosen), Cephalaria gigantea (Riesen-Schuppenkopf) und Phlomis russeliana (Brandkraut) sind dafür zum Beispiel geeignet (blühen aber allesamt gelb). Gut eingewachsene Exemplare von Campanula latifolia (Breitblättrige Wald-Glockenblume) dulden die Nähe dieses Weidenröschens ebenfalls (die Glockenblume ist zur Blütezeit des Weidenröschens allerdings bereits verblüht). Neben einer Aralia californica (Kalifornische Aralie) oder racemosa (Amerikanische Aralie) hingegen gibt es schnell auf. Die Wuchsfreude der Aralien ist selbst für das Wald-Weidenröschen zu viel.
Arbeiten Sie am besten mit der Fernwirkung des Weidenröschens, das erspart dem Weidenröschen und Ihnen – zumindest einigermaßen – das Problem mit den direkten Nachbarn. Besonders reizvolle Bilder ergeben sich, wenn Epilobium angustifolium mit höheren Nachbarpflanzen leicht verwoben ist, allerdings sollte diese enge Nachbarschaft eben nur in der Höhe stattfinden, denn in Pflanzenhorste hineingewanderte Weidenröschen lassen sich kaum mehr entfernen.

Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen) als Hintergrund für Clematis mandshurica (Mandschurische Waldrebe)
Der zweite Nachteil ist die Selbstaussaat. Epilobium angustifolium bildet (bereits während der Blüte) reichlich Samen, deren bezaubernde Optik den beherzten Griff zur Gartenschere erschwert. Trotzdem sollten sie sich von den zarten, perückenartigen Gebilden nicht um den Finger wickeln lassen, sonst trägt der Wind die Samen in jede Ecke des Gartens. Dass die Samen Lichtkeimer sind, schraubt zudem die Keimrate in die Höhe und fördert die Verbreitung der Pflanzen (tröstlich: besonders lange keimfähig [über Jahrzehnte also] sollen die Samen nicht sein). Ergo: Mit dem Rückschnitt der Blütenstängel nicht zu lange warten, wenn erst mal die Samen zu reifen begonnen haben. (Abgeschnittene Blütentriebe packt man sicherheitshalber am besten gleich an Ort und Stelle in die Biomülltonne oder einen Gartenabfallsack, der zu einer Sammelstelle gebracht wird.) Epilobium angustifolium wird nichts Besseres zu tun haben, als möglichst schnell neue Blütenstände hervorzubringen, darauf können wir uns verlassen.
In naturnahen Gärten
Naturnaher Garten:
Ein Garten, der weitgehend unter Verwendung von einheimischen Pflanzen angelegt ist.
und Wildstaudenpflanzungen
Wildstaudenpflanzungen:
Pflanzungen, die unter Verwendung von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen – keine Züchtungen – weitgehend sich selbst überlassen werden; der Gärtner greift nur gelegentlich ordnend ein. Eine Wildstaudenpflanzung kann sich über den ganzen Garten erstrecken oder auf einzelne Bereiche beschränken.
ist die Vermehrung mittels Selbstaussaat Teil des Prinzips und jedes neue Pflänzchen willkommen. Am besten also wachsam sein, jedoch nicht übervorsichtig, damit es Ihnen nicht so geht wie mir: Vor lauter Sorge, das Weidenröschen könnte überhandnehmen, habe ich es so gut kontrolliert, dass es eines Jahres komplett verschwunden war. Dumm gelaufen.
Wildbienen auf dem Schmalblättrigen Weidenröschen
 Schön wirkt das Schmalblättrige Weidenröschen, wenn einzelne Pflanzen als leuchtende Farbtupfer Pflanzengruppen mit zarten, pastelligen Blütenfarben beleben (wäre da nicht das Problem mit den Ausläufern und den Samen). Noch schöner fast sind großflächigere Pflanzungen, etwa vor Hecken. So ein "Massenaufkommen" ist dann auch für Wildbienen-Arten interessant, die ihre Larven in den Nestern mit Weidenröschen-Pollen versorgen (nur die Weibchen sind dafür zuständig). In Deutschland sind das die Sandbiene Andrena thoracica sowie die Blattschneiderbienen Megachile circumcincta, lapponica, maritima und willughbiella.
Schön wirkt das Schmalblättrige Weidenröschen, wenn einzelne Pflanzen als leuchtende Farbtupfer Pflanzengruppen mit zarten, pastelligen Blütenfarben beleben (wäre da nicht das Problem mit den Ausläufern und den Samen). Noch schöner fast sind großflächigere Pflanzungen, etwa vor Hecken. So ein "Massenaufkommen" ist dann auch für Wildbienen-Arten interessant, die ihre Larven in den Nestern mit Weidenröschen-Pollen versorgen (nur die Weibchen sind dafür zuständig). In Deutschland sind das die Sandbiene Andrena thoracica sowie die Blattschneiderbienen Megachile circumcincta, lapponica, maritima und willughbiella.
Die Garten-Blattschneiderbiene (Megachile willughbiella – Flugzeit Ende Juni bis Ende August, nur in heißen, langen Sommern eine zweite Generation ab Mitte August) und die Weidenröschen-Blattschneiderbiene (Megachile lapponica – Flugzeit Anfang Juni bis Mitte August, eine Generation/

Garten-Blattschneiderbiene (Megachile willughbiella – Weibchen) auf Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen)
Megachile lapponica, die Weidenröschen-Blattschneiderbiene, sammelt nach allem, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, ausschließlich Pollen von Weidenröschen als Proviant für ihre Larven (die anderen hier genannten Arten dagegen Pollen von Pflanzen aus verschiedenen Gattungen und Familien). Von ihr gibt es zudem die gute Nachricht, dass ihre Bestände und ihre Verbreitung in Deutschland offenbar wachsen. Das freut mich mal so richtig!
Bienen, die lediglich auf den Nektar des Weidenröschens aus sind, treffen Sie am häufigsten um die Mittagszeit; um 13 Uhr bietet Epilobium angustifolium den meisten Nektar an. (13°°, das hat man ermittelt, aber ob 13°° Normalzeit oder 13°° Sommerzeit, das hat man nicht dazugeschrieben; guter Gedanke also, aber nicht zu Ende gedacht.)
Lust auf mehr? Meine Seite Wildbienen im Stauden-Garten informiert Sie ausführlicher über Wildbienen, die Gartenstauden als Pollenquellen schätzen, und über die Lebensweise dieser ebenso faszinierenden wie gefährdeten Insekten.
Epilobium angustifolium – Wald-Weidenröschen, Schmalblättriges Weidenröschen
| Wuchshöhe: | 70-230 cm |
| Blütenfarbe: | leuchtend rosa bis rosarot |
| Blütezeit: | Juni, Juli, August, September |
| Lichtverhältnisse: | sonnig-halbschattig |
| Bodenverhältnisse: | frisch |
| Verwendung: | |
| Hinweis: | einheimische Pflanze, Pollenquelle für Wildbienen |
Literatur: Paul Westrich, Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer-Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2018, ISBN 978-3-8186-0123-2
Zum Seitenanfang
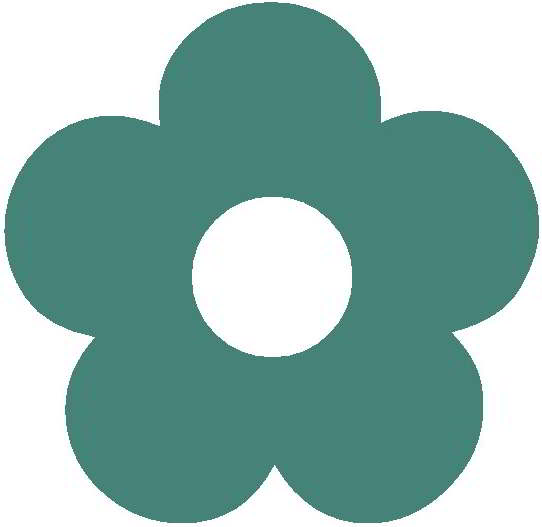
Weitere Staudengattungen
Achillea (Schafgarbe)
Acinos (Steinquendel)
Aconitum (Eisenhut)
Aconogonon (Bergknöterich)
Agastache (Duftnessel)
Ajuga (Günsel)
Alcea (Stockrose)
Alchemilla (Frauenmantel)
Althaea (Eibisch)
Alyssum (Steinkraut)
Amsonia (Blausternbusch)
Anaphalis (Perlkörbchen)
Androsace (Mannsschild)
Anemone (Anemone)
Antennaria (Katzenpfötchen)
Anthericum (Graslilie)
Aquilegia (Akelei)
Arabis (Gänsekresse)
Aralia (Aralie)
Arenaria (Sandkraut)
Armeria (Grasnelke)
Artemisia (Silberraute)
Aruncus (Geißbart)
Asphodeline (Junkerlilie)
Aster (Aster)
Astrantia (Sterndolde)
Aurinia (Steinkresse)
Baptisia (Indigolupine)
Bergenia (Bergenie)
Brunnera (Kaukasusvergissmeinnicht)
Buglossoides (Steinsame)
Calamintha (Bergminze)
Campanula (Glockenblume)
Centaurea (Flockenblume)
Cephalaria (Schuppenkopf)
Chamaemelum (Römische Kamille)
Chrysanthemum (Chrysantheme)
Clematis (Waldrebe)
Clinopodium (Bergminze)
Coreopsis (Mädchenauge)
Cymbalaria (Zimbelkraut)
Datisca (Scheinhanf)
Delphinium (Rittersporn)
Dianthus (Nelke)
Dictamnus (Diptam)
Digitalis (Fingerhut)
Dracocephalum (Drachenkopf)
Dryas (Silberwurz)
Echinacea (Scheinsonnenhut)
Echinops (Kugeldistel)
Echium (Natternkopf)
Epilobium (Weidenröschen)
Eryngium (Edeldistel, Mannstreu)
Euphorbia (Wolfsmilch)
Eurybia (Aster)
Filipendula (Mädesüß)
Gaillardia (Kokardenblume)
Galatella (Aster)
Gaura (Prachtkerze)
Gentiana (Enzian)
Geranium (Storchschnabel)
Geum (Nelkenwurz)
Gillenia (Dreiblattspiere)
Gypsophila (Schleierkraut)
Helenium (Sonnenbraut)
Helianthemum (Sonnenröschen)
Helianthus (Sonnenblume)
Heliopsis (Sonnenauge)
Helleborus (Christrose, Nieswurz)
Hemerocallis (Taglilie)
Herniaria (Bruchkraut)
Heuchera (Purpurglöckchen)
Hosta (Funkie)
Hypericum (Johanniskraut)
Hyssopus (Ysop)
Iberis (Schleifenblume)
Jasione (Sandglöckchen)
Kalimeris (Schönaster)
Knautia (Witwenblume)
Kniphofia (Fackellilie)
Lamium (Goldnessel)
Lavandula (Lavendel)
Leonurus (Herzgespann)
Leucanthemum (Garten-Margerite)
Liatris (Prachtscharte)
Ligularia (Goldkolben)
Limonium (Strandflieder, Meerlavendel)
Linaria (Leinkraut)
Linum (Lein)
Lithospermum (Steinsame)
Lupinus (Lupine)
Lychnis (Lichtnelke)
Lysimachia (Felberich)
Lythrum (Weiderich)
Malva (Malve)
Melissa (Melisse)
Mentha (Minze)
Monarda (Indianernessel)
Nepeta (Katzenminze)
Oenothera (Nachtkerze)
Oligoneuron (Aster)
Origanum (Dost, Oregano, Majoran)
Paeonia (Pfingstrose)
Papaver (Mohn)
Penstemon (Bartfaden)
Petrorhagia (Felsennelke)
Phlomis (Brandkraut)
Phlox (Flammenblume)
Platycodon (Ballonblume)
Polemonium (Jakobsleiter)
Polygonatum (Salomonssiegel)
Potentilla (Fingerkraut)
Primula (Aurikel, Schlüsselblume, Primel)
Prunella (Braunelle)
Pseudofumaria (Lerchensporn)
Pulmonaria (Lungenkraut)
Pulsatilla (Kuh-/Küchenschelle)
Rudbeckia (Sonnenhut)
Ruta (Raute)
Salvia (Salbei)
Sanguisorba (Wiesenknopf)
Saponaria (Seifenkraut)
Satureja (Bohnenkraut)
Saxifraga (Steinbrech)
Scabiosa (Skabiose)
Sedum (Fetthenne)
Sempervivum (Hauswurz)
Sideritis (Bergtee)
Silene (Leimkraut)
Solidago (Goldrute)
Stachys (Ziest)
Symphyotrichum (Aster)
Symphytum (Beinwell)
Tanacetum (Bunte Margerite)
Teucrium (Gamander)
Thalictrum (Wiesenraute)
Thymus (Thymian)
Tiarella (Schaumblüte)
Tradescantia (Dreimasterblume)
Trifolium (Klee)
Trollius (Trollblume)
Verbascum (Königskerze)
Verbena (Verbene)
Vernonia (Scheinaster)
Veronica (Ehrenpreis)
Veronicastrum (Arzneiehrenpreis)
Vinca (Immergrün)
Viola (Veilchen)
Waldsteinia (Waldsteinie)
Yucca (Palmlilie)

 größeres Bild
größeres Bild